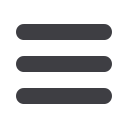
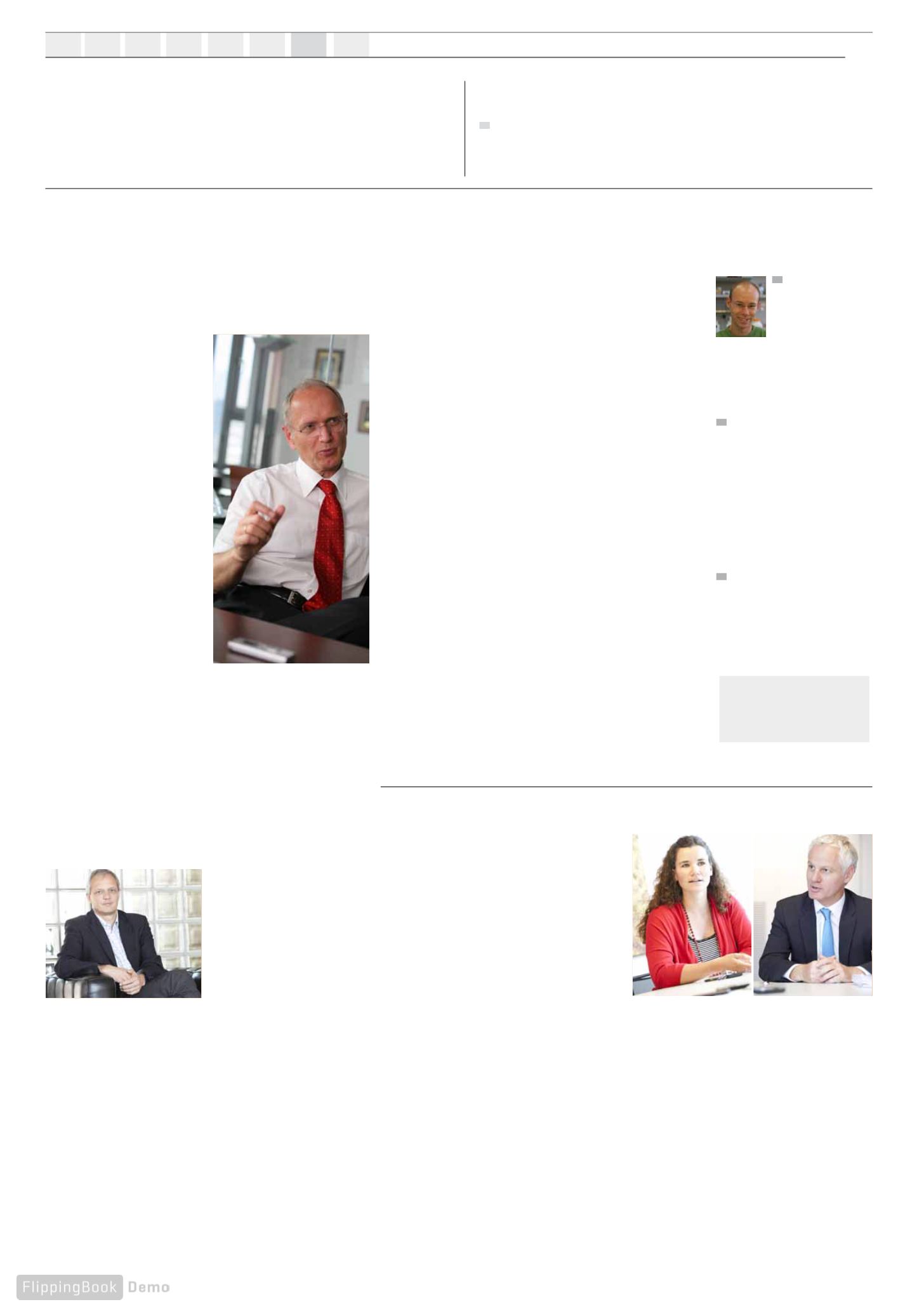
3 2 1
4 5 6
7
8
0314
standort
A
b 2015 können Studieren-
de am Management Center
Innsbruck (MCI) ein Mehr-
fachdiplom an vier Hochschulen in
Europa erwerben. Ausgangspunkt
war das vom MCI 2008 eingeführte
Masterstudium Health & Social Ma-
nagement, das international sehr
viel Aufmerksamkeit erregte. Auf
Anfrage der Erasmus Universität in
Rotterdam und den Universitäten
Oslo sowie Bologna verknüpfte das
MCI in den letzten fünf Jahren sein
Masterstudium mit deren Aktivi-
täten. Die Studierenden starten ihr
Studium jeweils an der heimischen
Hochschule und können dieses
unter voller Anrechnung der er-
brachten Leistungen an einer der
Partnerhochschulen
fortführen
und mit dem „European Master in
Health Economics & Management“
abschließen.
„Schon seit einigen Jahren ge-
winnen Gesundheitshemen in den
Grenzregionen der EU-Staaten an
Bedeutung, siehe das Beispiel Zahn-
ärzte in Ungarn, aber auch die neue
Richtlinie der EU zur Patienten-
mobilität erfordern mehr interna-
tionale Ausbildung und Erfahrung
für künftige Gesundheitsexperten“,
erläutert Siegfried Walch, Leiter des
Departments Nonprofit-, Sozial- &
Gesundheitsmanagement am MCI.
Der Grundgedanke des Masterstudi-
ums ist, dass die Qualität der Ange-
bote internationaler Gesundheitssy-
steme vergleichbar werden soll. Dies
ist notwendig, um die Leistungen in
diesen Systemen auch kalkulieren
zu können. „Wir gehen davon aus,
dass einerseits auf die schwächeren
Gesundheitssysteme Druck entsteht,
ihr Angebot zu verbessern, anderer-
seits aber auch auf die starken Ge-
sundheitssysteme Druck ausgeübt
wird, ihre Angebote entsprechend
detailliert zu beschreiben“, soWalch.
Die neue Ausbildung soll in diesem
Kontext Absolventen ausbilden, die
über diese verschiedenen Systeme
hinweg vermitteln und verhandeln
können. Info:
www.mci.edu]
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Life Science ]
Neues Mehrfachdiplom
Das MCI bietet ein Masterstudium für Entscheidungs-
träger im internationalen Gesundheitsmanagement.
Die weltweit renommierte Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie arbeitet an vielversprechenden
internationalen Projekten zur besseren Früherkennung und Behandlung des Parkinson-Syndroms.
Forschung ist die beste Medizin
Für seine Forschungsar-
beiten zur Verbesserung von
Diagnose und Therapie von
Pilzinfektionen wurde Mario
Gründlinger (im Bild) von der
Sektion für Molekularbiologie
des Innsbrucker Biozentrums mit dem Dr.
Otto Seibert Wissenschafts-Förderungspreis
ausgezeichnet. Der Dr. Otto Seibert Preis
für Forschung zur Förderung gesellschaftlich
Benachteiligter ging an Martin Kumnig von der
Uniklinik für Medizinische Psychologie.
Der Jubiläumsfonds der Österreichischen
Nationalbank hat sieben Projekte genehmigt,die
an der Medizinuniversität Innsbruck durch-
geführt werden. Damit erhält Innsbruck rund
ein Drittel des Fördertopfs für den Bereich
„Medizinische Wissenschaft“. Unterstützt
werden Forschungsvorhaben zu Alzheimer, der
Atherogenese, Atherosklerose, Schlafapnoe,
Schlaganfall, ZNS-Erkrankungen und dem
Prostatakarzinom. Ebenfalls zum Zug kam die
Medizinuni beim FWF, der neue Drittmittel für
drei Einzelprojekte sowie ein T-Projekt aus dem
Hertha-Firnberg Programm genehmigte.
Die TILAK hat mit der Gesundheitsinitiative
„HerzMobil Tirol“ beim diesjährigen „eHealth
Summit Austria“ den begehrten E.T. Award für
innovative Patientenkommunikation gewonnen.
Ziel der Initiative ist es, das Versorgungsmodell
für Patienten mit Herzschwäche auf eine völlig
neue Basis zu stellen.
[ konkret GEFRAGT]
TGKK fördert „Gesunde Schule Tirol“
STANDORT:
Was steht hinter „Gesunde Schule Tirol“?
ARNO MELITOPULOS:
Wir verfolgen mit dieser Initiative
den Grundsatz „Health in All Policies“. Dieser geht von der Er-
kenntnis aus, dass die Gesundheit der Bevölkerung nur durch
gebündelte Anstrengungen in allen Politikfeldern, man könnte
auch sagen in allen Lebenswelten, wirksam und nachhaltig
gefördert werden kann. Wir sind der Meinung, wir sollten als
Tiroler Gebietskrankenkasse auch den gesunden Menschen
abholen und ihn unterstützen, damit er nach Möglichkeit auch
gesund bleibt. Und hier bieten sich unsere Schulen an, denn
hier gibt es enormes pädagogisches und kreatives Potential.
STANDORT:
Wie sieht diese Initiative in der Praxis aus?
ELISA SCHORMÜLLER:
Unsere Projekte reichen derzeit
von „Do it yourself“, einem Pilotprojekt zur maßgeschneiderten
Gesundheitsbefragung und schulindividuellen Umsetzung an
Tiroler AHS und BHS, über „Gesunde Schule Tirol“, wo 20
Tiroler Schulen ihre Schule in einem umfassenden professionell
moderierten Programm gesünder gestalten, bis hin zum Projekt
„Schule bewegt gestalten“, mit Bewegungs-Equipment zur be-
wegten Pausengestaltung sowie dem Ernährungsführerschein,
einem umfassenden Ernährungs-Bildungsprogramm samt „Kit-
chenbox“ für jede teilnehmende Schule. Dazu kommt noch die
Initiative „Gesund rund um den Mund“, also Zahngesundheits-
vorsorge im Haus der Gesundheit der TGKK, an der jährlich
rund 1000 Schülerinnen und Schülern teilnehmen.
MELITOPULOS
: Wir haben als Grundlage ein sogenanntes
„Haus der gesunden Schule“ definiert und das beinhaltet alle
wichtigenThemen: Ernährung, Bewegung, Psychosoziale Ge-
sundheit, Suchtprävention, LehrerInnengesundheit sowie das
Lehren und Lernen, also die Gestaltung des Unterrichts.
STANDORT:
Wie soll das in Zeiten knapper Budgets von den
Schulen finanziert werden?
MELITOPULOS:
Das ist natürlich eine zentrale Frage. Wir
haben als ersten Schritt ein fünfköpfiges Team „Gesundheitsför-
derung“ aus kompetenten Spezialisten zusammengestellt und
stellen auch die erforderlichen finanziellen Mittel zur Umset-
zung von Gesundheitsförderungs- und Vorsorge-Projekten an
den Schulen zur Verfügung. Auf dem Weg zur gesunden Schule
sind zudem die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit
professionellen Partnern wie dem Landesschulrat maßgebliche
Erfolgsfaktoren. Frau Landesrätin Beate Palfrader, seit Jänner
dieses Jahres Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates,
unterstützt uns bei unserer Initiative ganz enorm.
STANDORT:
Könnte man Ihre Zielvorgaben generell defi-
nieren?
MELITOPULOS:
Grundsätzlich ist es einmal so, dass wir ver-
suchen wollten, uns als Sozialversicherung im Bereich Gesund-
heitsförderung Schritt für Schritt zu etablieren. Natürlich haben
wir uns im Vorfeld überlegt, wie können wir das angehen und in
welchen „Lebensfeldern“ wollen wir uns engagieren, wo wol-
len wir präsent sein und das immer im Bewusstsein, dass die
Gesundheitsförderung der „Ressourcen-Pool“ der Zukunft ist.
Wir sind auch gemeinsammit Beate Palfrader in Verhandlungen,
haben bereits einen Entwurf gestaltet und sind auf einem guten
Weg, eine wirklich umfassende und langfristige Zieldefinition zu
erarbeiten. Ein dezidiertes Ziel ist es auf jeden Fall im Endausbau
ein Gütesiegel „Gesunde Schule“ zu schaffen, auch um genaue
Qualitätsstandards zu definieren und dadurch eine Vergleich-
barkeit zu schaffen. (Info:
www.tgkk.at)
TGKK-Direktor Arno Melitopulos und die Leiterin des „Team
Gesundheitsförderung“ Elisa Schormüller
Siegfried Walch, Leiter des Departments
Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsma-
nagement am MCI
Fotos: Türtscher
E
s war ein berührender Mo-
ment, als Muhammad Ali
1996 das Olympische Feu-
er in Atlanta entzündete, schwer
gezeichnet von Parkinson, einer
Erkrankung, die immer mehr Men-
schen betrifft und bis heute nicht
heilbar ist. Die Parkinson-Syndrome
stellen eine Gruppe von langsam
fortschreitenden, neurologischen
Erkrankungen dar, die auf das Ab-
sterben der Dopamin produzie-
renden Nervenzellen im Gehirn
zurückzuführen sind. Zu den Sym-
ptomen zählen Bewegungsarmut,
Muskelsteifheit, Ruhe-Zittern so-
wie Gang- und Gleichgewichtsstö-
rungen.
„Wir wissen aber heute aus in-
ternationalen Studien, dass viele
Parkinson-Patienten schon vor dem
Auftreten der ersten motorischen
Symptome andere Dysfunktionen
entwickeln“, so Werner Poewe,
Direktor der Univ.-Klinik für Neu-
rologie in Innsbruck und weltweit
anerkannter Parkinson-Experte. Im
Frühstadium werden etwa die chro-
nische Obstipation (Verstopfung),
aber auch Stimmungsstörungen mit
Depressivität oder Panikattacken
beobachtet. Auch die Störung des
Geruchssinns und die nächtliche
REM-Schlafstörung können frühe
Indikatoren sein. „Hier wollen wir
mit einem neuen Projekt ansetzen
und einen statistisch verwertbaren
Risiko-Score erarbeiten“, erklärt
Poewe. Mit dem für eine EU-Förde-
rung eingereichten Projekt möch-
ten die Experten an der Klinik für
Neurologie über ein Internet basier-
tes Programm so vieleMenschen wie
möglich erreichen, um mit einem
Fragenkatalog und verschiedenen
Tests eine Risikoberechnung an
Hand von schon länger bekannten
Risikofaktoren durchzuführen. „Die
wichtigste Frage ist für uns: Kann
man dann bei der Nachuntersu-
chung von Menschen mit erhöhtem
Risiko die Ergebnisse des Projekts
validieren, sodass es für eine breit
angelegte Risikovorsorge tauglich
ist“, beschreibt Poewe einen weite-
ren Schritt.
„Parkinson ist durch die Einnah-
me von Medikamenten sehr gut
behandelbar“, betont der Medizi-
ner. Doch für einen langfristigen
Behandlungserfolg, sowohl in der
Früherkennung als auch in der
möglichst schnellen Bestimmung
nach Ausbruch der Krankheit, sind
diagnostische Marker enorm wich-
tig. Ein Team unter der Leitung von
Poewe arbeitet intensiv an der Iden-
tifikation von Parkinson-Biomar-
kern, darunter auch sogenannte
Alpha-Synuklein-Biomarker. Alpha-
Synuklein ist ein Protein im Gehirn,
das unter anderem die Dopamin-
Ausschüttung reguliert.
Zudem arbeitet das Team gemein-
sam mit einem Wiener Biotech-
Unternehmen an einem Impfstoff.
Dieser wird derzeit in klinischen Un-
tersuchungen erprobt. Und er wirkt
– das zeigten Tierversuche – spezi-
fisch gegen das Alpha-Synuklein,
dessen Anreicherungen im Gehirn
für das Fortschreiten von Parkinson
als ursächlich angesehen werden.
Generell sind die Forscherinnen
und Forscher der Innsbrucker
Neurologie in zahlreiche nationale
und internationale Projekte ein-
gebunden. So arbeitet Poewe eng
mit Gregor Wenning, Professor für
klinische Neurobiologie an der Me-
dizinischen Universität Innsbruck,
zusammen, der in den letzten Jah-
ren den international erfolgreichen
Schwerpunkt zur Multisystematro-
phie (MSA, einer besonders aggres-
siven Art von Parkinson) aufgebaut
und mit Poewe eine europäische
MSA-Studiengruppe etabliert hat.
„Das Wichtigste sei aber“, so der
Neurologe abschließend, „dass For-
schung immer am Wohl des Men-
schen orientiert sein muss. Das
heißt, wir wollen unsere Forschung
auch in die Versorgung übersetzen.“
Info:
www.i-med.ac.at/neurologie]
Foto: Türtscher
Foto: Medinzinuni
Medizinische Universität Innsbruck fördert wissenschaftliche Arbeit von Frauen
Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]
Um die wissenschaftliche Arbeit von Frauen an der Medizinischen Universität Innsbruck auszuzeichnen, wur-
de 2014 zum zweiten Mal ein Preis für die höchste Drittmitteleinwerbung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin
und für die beste PhD-Thesis ausgeschrieben. Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Gabriele Baier (Sektion für Neurobiochemie)
und Ass.-Prof.in Dr.in Elke Griesmaier (Univ.-Klinik für Pädiatrie II) konnten die Auszeichnungen heuer von Rekto-
rin o. Univ.-Prof.in Helga Fritsch entgegennehmen.
Science
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Life Sciences Tirol finden Sie auf
www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
„Wir wollen einen
statistisch verwert-
baren Risiko-Score
erarbeiten.“
Werner Poewe, Klinik für Neurologie
Foto: Friedle
















