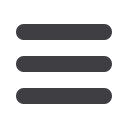

3
2 1
4 5 6 7 8
0115
STANDORT
Thema: [ ERNEUERBARE ENERGIENTIROL ]
Bis zu fünf Millionen Euro stehen bis Ende Oktober 2015 in dem Förderprogramm „Mustersanie-
rung“ des Klima- und Energiefonds für Sanierungen von Betriebs- oder öffentlichen Gebäuden zur Verfü-
gung. Durch die Sanierung auf höchstem Niveau, den Einsatz erneuerbarer Energien und die Steigerung
der Energieeffizienz werden die Emissionen der sanierten Häuser auf ein Minimum reduziert – oder zur
Gänze eingespart. Mehr Informationen unter
www.klimafonds.gv.at/mustersanierung.ENERGIE
Fünf Millionen Euro für Best-Practice-Sanierungen
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Erneuerbare Energien Tirol finden Sie
au
fwww.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Energie ]
Die E-Sorp GmbH aus Langkampfen
untersuchte im Projekt NexGen mit den Pro-
jektpartnern AIT undTU Graz die Einsatztaug-
lichkeit von gasbetriebenen Absorptionswär-
mepumpen für den kleinen Leistungsbereich
und die dafür nötigen Prozessmodifikationen.
Mit der entwickelten „E-Sorp-Schaltung“
konnte am Prüfstand eine sehr hohe Effizienz
(180 % imVergleich zu Gas-Brennwertgerä-
ten) erreicht werden. Die nächste Generation
der Gasabsorptionswärmepumpen soll nach
etwa zwei Jahren Feldtests in Zusammenar-
beit mit Industriepartnern in Serie gehen.
Das LandTirol hat sich das Ziel gesetzt,
Tirol in der Energieversorgung unabhängig zu
machen sowie sichere und saubere Energie
effizient einzusetzen. Gestartet wurde dafür
die Initiative für ein Energieautonomes Tirol
2050.Was in diesem Bereich passiert, kann
auf einer interaktivenTirol-Karte eingesehen
werden, wobei jeder eingeladen ist, Projekte
– egal ob Solaranlage am Dach, Firmen-E-Bike
oder bewusstseinsbildendes Gemeindeprojekt
– einzubringen. Mehr zu Energieautonomes
Tirol 2050 auf
www.tirol2050.atV
orne kommt gehacktes Holz
rein, hinten kommen Strom
und Wärme raus – doch
wenn es so einfach wäre, würde nicht
viel Kopfarbeit, eine Portion Entwick-
lungszeit und eine Menge Technologie
drin stecken. 2006 entwickelten MCI-
Forscher rund um Marcel Huber einen
Schwebefestbettvergaser, 2007 kam
es zur Gründung des Unternehmens
SynCraft, 2009 nahm am Gelände der
Stadtwerke Schwaz der CraftWERK-
Prototyp mit der inzwischen paten-
tierten Technologie seinen Betrieb auf,
2012 folgte der erste kommerzielle
Prototyp im Südtiroler Vierschach und
seit Dezember 2014 steht nun ein Craft-
WERK in Dornbirn. „Seither haben
wir in Vorarlberg rund 200.000 kWh
Ökostrom ins Netz eingespeist, jetzt
kommen monatlich 100.000 dazu“,
berichtet Huber, der noch auf weitere
CraftWERK-Details verweisen kann.
„Unser Ausgangsmaterial – und das
ist ein immenser Vorteil gegenüber an-
deren Technologien – muss nicht groß
aufbereitet werden“, so der Unterneh-
mer. Alles, was der Wald hergibt – Holz
inklusive Rinde und Feinanteil – kommt
in die Anlage, lediglich gehackt und ge-
trocknet. DieUmwandlung vonHolz zu
Gas erfolgt nun schrittweise, durch die
einzigartige Technologie entsteht ein,
so Huber, sehr reines Gas, das, bevor
es in den Gasmotor geschickt wird, um
dort Strom zu erzeugen, abgekühlt und
entstaubt wird. Und selbst die dabei an-
fallende Biokohle muss nicht entsorgt,
sondern kann genutzt werden: Dünger
beigemengt, verhindert sie, dass dieser
ausgewaschen wird, als Güllezusatz
mindert sie die Geruchsbelästigung.
„Unsere zwei CraftWERKE produzie-
ren 100 Tonnen Biokohle im Jahr, die
verkauft wird. Die Reste, die bei ande-
ren Systemen Kosten verursachen, zah-
len bei uns das Personal“, lacht Huber,
der derzeit in einem Forschungsprojekt
noch weitere Einsatzgebiete für die Bi-
okohle – etwa als Antibiotika-Ersatz im
Tierfutter – untersucht.
Nach Vorarlberg hat es das Craft-
WERK durch einen Vortrag von Hu-
ber in Salzburg verschlagen. „Tobias
Ilg, der Betreiber des EnergieWerks
in Dornbirn, war vor allem davon
begeistert, dass er – ohne spezielles
Hackgut oder Pellets – aus Holz Strom
erzeugen kann“, sagt Marcel Huber.
Genutzt werden kann also heimische
Biomasse, was die Wertschöpfung vor
Ort steigert. Zudem sei dadurch auch
der Brennstoffpreis im Vergleich zu
anderen günstig, was die – zugegeben
höheren – Kosten eines CraftWERKS
gegenüber anderen Holzgasanlagen
rechtfertigen würde.
Die innerhalb von drei Monaten
errichtete Anlage in Dornbirn ist für
Huber das erste „kommerzielle De-
monstrationsprojekt“, mit dem Bau
von zwei weiteren CraftWERKEN
schaut es mehr als gut aus, „dazu ha-
ben wir noch einige weitere heiße Ei-
sen im Feuer“. Gute Aussichten für
ein Projekt, das eigentlich „nur“ zwei,
drei Jahren Entwicklungszeit haben
sollte: „Dass es sieben werden, muss
man als Unternehmen erst verkraf-
ten.“ Einiges Glück habe er gehabt,
gibt Huber zu, geholfen haben in die-
ser Zeit auch Förderungen von CAST,
aws, FFG und Land Tirol, jetzt aber,
meint er zuversichtlich, „haben wir ein
Produkt, das man verkaufen kann.“
Weitere Informationen findet man auf
www.syncraft.at]
A
llein dieWortwahl sagt viel aus:
Was früher Abfall – oder gar
Mist – war, nennt man heu-
te Reststoff. Und Reststoff, das klingt
schon so, als ob da noch was drin wäre,
aus dem man etwas machen kann.
Was genau, das zeigt die Projektgrup-
pe ARAFerm, in der sich Vertreter von
Wissenschaft und Wirtschaft mit der
Frage befassen, wie biogene Reststoffe
(noch) besser für die Biogasproduktion
genutzt werden können. Und die Zwi-
schenbilanz des Projekts überrascht.
Im Prinzip klingt es einfach. Bio-
gene Reststoffe – Bioabfall, Küchen-
reste, Klärschlamm etc. – werden in
Reaktoren bei bestimmten Umge-
bungsbedingungen von Bakterien zu
Methan vergoren, Methan wiederum
kann zur Erzeugung von Strom und
Wärme genutzt werden. „Über ganz
Tirol verteilt verfügen rund 40 Abwas-
serverbände über Anlagen, in denen
aus Klärschlamm Methan gewonnen
wird. Mit dem Klärschlamm allein
sind viele Anlagen aber nicht ausgela-
stet, deswegen werden externe biogene
Reststoffe zugeführt“, beschreibt Pro-
jektleiter Christian Ebner das Prinzip
der Co-Fermentation: „Tirol gilt in
diesem Bereich als Pilotregion.“ Schon
ein beträchtlicher Teil der in Tirol an-
fallenden organischen Reststoffe wird
co-fermentiert. Das Ziel der Projekt-
partner Höpperger, IKB und ARA
Pustertal AG ist es, gemeinsam mit den
Universitätsinstituten für Mikrobiolo-
gie und Infrastruktur sowie dem Kom-
petenzzentrum alpS diesen Prozess zu
optimieren: Wie muss das Biosubstrat
zusammengesetzt sein, um die best-
mögliche Gasproduktion zu erreichen?
Wie wirken sich Störstoffe – Sand,
Glas, Plastik etc. – aus und wie kann
man sie dem Substrat entziehen? Wie
und wann kann man das Substrat opti-
mal einsetzen?
„Unsere Annahme war, dass das
Substrat so schnell wie möglich zu Me-
than umgewandelt werden muss, da-
mit keine Energie verloren geht“, blickt
Ebner auf den Projektbeginn zurück.
Forschungsergebnisse, die demnächst
publiziert werden, zeigen aber, dass der
biogene Reststoff, der sich, so Ebner,
wie „Sauerkraut durch Milchsäuregä-
rung stabilisert“, länger als ein Monat
gelagert werden könnte. „Wir können
also Methan zu dem Zeitpunkt erzeu-
gen, an dem es gebraucht wird.“ Doch
das Biosubstrat barg noch eine weitere
Überraschung. Ebner: „Es hilft, den
Klärschlamm besser abzubauen, es
bleibt weniger, teuer zu entsorgender
Restschlamm übrig.“ Warum das so ist,
soll nun in dem COMET-geförderten
alpS-Projekt bis 2017 genauer unter-
sucht werden. ]
Foto:SynCraft
SynCraft-Gründer Marcel Huber (li.)
und Tobias Ilg vom EnergieWerk in der
Dornbirner CraftWERK-Anlage, in der
auch Biokohle in Bigbags abgefüllt wird.
ARAFerm-Projektleiter Christian Ebner,
zwei Versuchsfaultürme im Labor.
Fotos:ARAFerm
Vom ersten Schwebefestbettvergaser über das Start-up bis zur kommerziellen Demo-Anlage war es ein langer
Weg – das Dornbirner Referenz-CraftWERK soll nun der Startschuss für weitere Anlagen von SynCraft sein.
„Ein paar heiße Eisen im Feuer“
Fenster für alle (Wetter-)Lagen
[ konkret GESEHEN ]
„Es verhält sich wie Sauerkraut“
Das Projekt ARAFerm zeigt das Potenzial biogener Reststoffe: Der aufbereitete
Bioabfall kann gelagert werden und hilft, Klärschlamm besser abzubauen.
Foto:Marianne Mathis
Die neue CNC-Fensterfertigungsmaschine bei Freisinger.
Grafik:www.tirol2050.at
Foto:Biesse
E
s handelt sich um einen siebenstel-
ligen Betrag, den Freisinger Fenster-
bau in seiner Produktionshalle investiert.
Hauptkostenfaktor ist dabei die neue
CNC-Fensterfertigungsmaschine, aber
Adaptierungen in der Halle, neue Kom-
pressoren und eine stärkere Absaugung
schlagen sich auch zu Buche. Den
Grund für die beachtliche Investition in
den ProduktionsstandortTirol nennt
Geschäftsführer Herbert Noichl: „Für
die neue Produktlinie – derzeit umfasst
sie Fenster und eine Hebeschiebetür,
eine Haustür wird noch kommen – war
die neue Maschine einfach notwendig.“
Purista, Resista, Lignuma und Motura
nennen sich die Produkte der neuen
OPTIWIN-Linie, in der nicht nur mehr
als 20 Jahre Freisinger-Know-how beim
Bau energieeffizienter Fenster stecken,
sondern auch dasWissen von welt-
weiten OPTIWIN-Partnern. „Damit
konnten wir die Anforderungen, die
unterschiedlicheWetterbedingungen
an Fenster undTüren stellen, in die Ent-
wicklung einfließen lassen“, sagt Noichl.
Eine Entwicklung, die sich ganz dem
Thema energieeffiziente Fenster und
Türen verschrieben hat.
„Man kann heute“, weiß Noichl,
„Wände bis zu einem U-Wert – das
Maß für denWärmedurchgang durch
einen Bauteil – von 0,1 dämmen. Beim
Fenster wird aber oft gespart, eingebaut
werden welche mit einem U-Wert
von 1,0 und darüber.“Was wenig Sinn
macht, erreicht man doch mit Fenstern,
die eingebaut U-Werte von 0,6 bis 0,7
haben, mehr, so Noichl, „als mit einer
heruntergdämmtenWand“. Doch nicht
nur auf solche U-Werte, Qualität und
Design, Schallschutz und Schlagregen-
dichte legt man beim Ebbser Fenster-
spezialistenWert, sondern auch auf
Ökologie. „Wir dämmen mit Schafwol-
le, verwenden kein PVC, arbeiten kaum
mit Farben und Lacken, sondern mit
ökologisch wertvollen Ölen“, so Noichl,
dessenTeam Fenster undTüren mit der
neuen Anlage noch effizienter herstel-
len kann. Ende März wurde sie aufge-
baut, der April dient zum „Einfahren“,
ab Mai, ist Noichl zuversichtlich, sollen
die ersten Fenster der neuen Genera-
tion produziert werden – dass diese
passivhauszertifiziert sind, versteht sich
bei Freisinger eigentlich von selbst. Info:
www.freisinger.atbzw.
www.optiwin.net















