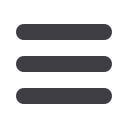
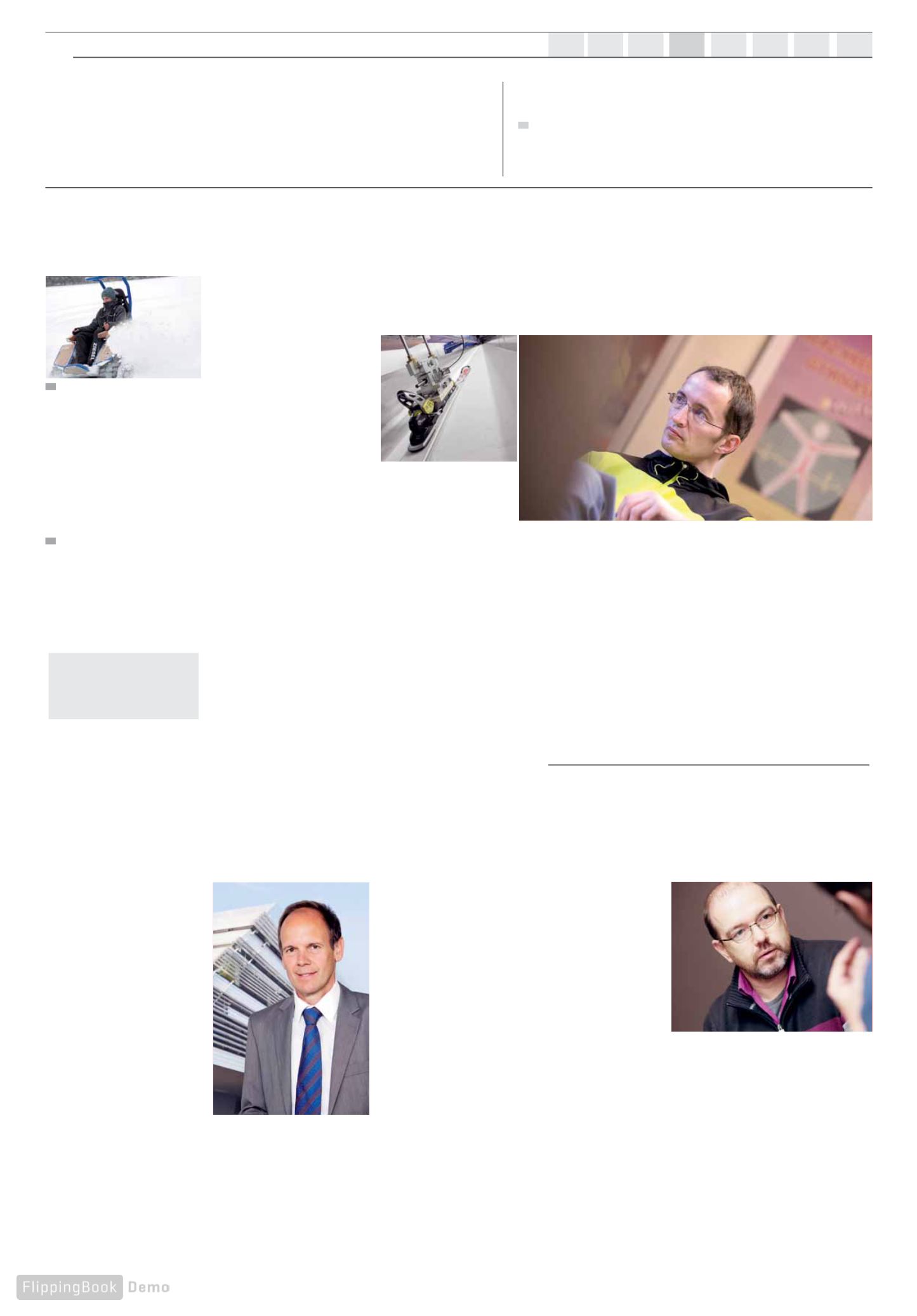
3
4
5 6 7 8
standort
0114
2 1
Elektromobilitätskongress 2014
Thema: [ MECHATRONIK TIROL ]
Technik
Mit Klischees wie „Elektromobilität funktioniert nicht“, „E-Autos werden noch lange auf sich warten
lassen“ oder „Ist viel zu teuer“ wollen die Cluster Mechatronik, Erneuerbare Energien und IT Tirol beim
Elektromobilitätskongress 2014 aufräumen. Realistische Zahlen, Daten und Fakten zeigen auf, dass Elek-
tromobilität nicht mehr in den Kinderschuhen steckt, sondern allgegenwärtig ist.
Datum: 17. (Fachkongress) und 18. (Öffentliche Ausstellung) Juni 2014; Ort: Congress Innsbruck
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Mechatronik Tirol finden Sie auf
www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Mechatronik ]
Ende Jänner feierte Clustermitglied
Mattro Mobility Revolutions den Marktstart
seines Ziesels, eines elektrisch betriebenen
Offroad-Fahrzeugs made in Tirol. Ohne
Motorenlärm und ohne Abgase, kinderleicht
zu bedienen mit präziser Joystick-Steuerung
präsentiert sich der Ziesel, dessen Entwicklung
mit dem Programm InnovationsassistentIn
Tirol gefördert wurde, als Fun- und Arbeits-
mobil. Wie viel Fun der Ziesel bereiten kann,
sahen am 15. Februar rund 3,19 Millionen
Zuschauer, als Stefan Raab im Ziesel nicht zu
schlagen war.
Vom 26. bis 28. Mai 2014 findet die drei-
tägige „International Summer School Mechatro-
nik“ statt (Veranstalter Cluster Mechatronik Ti-
rol, Cluster Mechatronik & Automation Bayern,
TiS innovation park Südtirol). Zum Thema
„Der Kollege Roboter für die Produktion der
Zukunft“ werden u.a. infrastrukturelle Voraus-
setzungen, die Mensch-Maschinen-Kooperation
und Investitionsbedarf beleuchtet.
M
oderne mechatronische
Zugänge bei der Ent-
wicklung von Maschi-
nen, Geräten und Anlagen er-
öffnen neue Möglichkeiten für
Produktinnovationen. Die Schlüs-
selfaktoren liegen dabei in erster
Linie im durchgängigen Erfassen
der Anforderungen an das Pro-
dukt, dem sogenannten „Require-
ments Engineering“, und im me-
chatronischen Design selbst.
„Der Grundgedanke dabei ist
die durchgängige Integration aller
notwendigen technischen Diszipli-
nen ab Beginn des Entwicklungs-
prozesses“, betont Gerald Schatz,
GF der LCM. Dabei ist, so der Me-
chatronik-Spezialist, für die Ent-
wicklung und Erarbeitung mecha-
tronischer Lösungen für komplexe
Produktionsprozesse die compu-
terunterstützte Simulation absolut
unumgänglich. „Der Umfang ei-
ner Simulation kann von den ein-
zelnen Komponenten einer neuen
Anlage über deren Funktionalität
im Betrieb bis hin zum Fertigungs-
prozess von Produkten reichen“,
erläutert Schatz. Diese durchgän-
gige Simulationskette schafft die
Basis für die Optimierung der Pro-
dukte bzw. der Herstellungspro-
zesse. Wesentlich ist die Berück-
sichtigung der mechanischen und
elektrischen Eigenschaften sowie
deren Zusammenwirken in der
Anlage, um Optimierungspoten-
zial zu identifizieren. In weiterer
Folge kann der Ressourceneinsatz,
wie zum Beispiel der Energiever-
brauch der gesamten eingesetzten
Betriebsmittel entlang der Pro-
duktionskette, optimiert werden.
Dabei werden nicht nur die ein-
zelnen Komponenten einer Anla-
ge optimiert, wie elektrische oder
hydraulische Antriebe. Vielmehr
wird das energieoptimierte Zusam-
menwirken der einzelnen Kompo-
nenten durch Simulation erfasst
und durch intelligente Software
und Sensorik in der betrieblichen
Praxis umgesetzt.
Ein wichtiger Aspekt ist die Inte-
gration der logistischen, produkti-
onsbegleitenden Prozesse, wie zum
Beispiel der Materialfluss.
Eine wesentliche zukünftige He-
rausforderung ist die Reduktion
der Vielzahl an Schnittstellen bzw.
deren Standardisierung, um tat-
sächlich durchgängige Automati-
onssysteme zu schaffen.
Es geht heute um die horizonta-
le und um die vertikale Integration
von Prozessabläufen. Man könnte
auch sagen, früher ging es um
Komponenten. In Zukunft geht
es um Prozesse, und dabei ist die
moderne Mechatronik zusammen
mit integrierter Software der Dreh-
und Angelpunkt. Mehr Informati-
onen unter
www.lcm.at]
Ganzheitliche Entwicklung von
Produkten ist der Schlüsselfaktor
Die Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM) ist ein Excellence Center für
moderne integrierte und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Mechatronik.
E
s ist eine Frage, die wohl
jeden Skifahrer brennend
interessiert: Wie muss ein
Ski bearbeitet werden, dass er a)
schnell ist, dass b) die Kanten lang
scharf bleiben und dass c) der Be-
lag länger hält. Geht es nach Mi-
chael Hasler, Projektmanager am
Innsbrucker Technologiezentrum
Ski- und Alpinsport, könnte die-
se brennende Frage mit Tiroler
Know-how gelöst werden.
Der Grund für seine Zuversicht
liegt am Projekt Skitechnologie,
einem vom Land Tirol und vom
europäischen EFRE-Fonds finan-
zierten K-Regio-Projekt. Darin
kooperieren das im Jahr 2005 ge-
gründete Technologiezentrum Ski-
und Alpinsport, die Uni Innsbruck
(Inst. f. Sportwissenschaft, Inst. f.
Grundlagen der Technischen Wis-
senschaften, Inst. f. Konstruktion
und Materialwissenschaften, Inst. f.
physikalische Chemie, Experimen-
talphysik), der ÖSV, die Tyrolit-
Schleifmittelwerke, der Spezialma-
schinenbauer Wintersteiger AG,
der Außerferner Beschichtungs-
experte PhysTech Coating Tech-
nology und der Skiwachsspezialist
HWK Kronbichler in Ebbs. Das
erklärte Ziel, so Michael Hasler:
„Wir wollen die Performance, die
Sicherheit und die Langlebigkeit
von Skiern verbessern.“ Man sei an-
fangs völlig offen gewesen, so Has-
ler, mit welcher Technologie dieses
Ziel erreicht wird, man greife aber
natürlich auf die Kompetenzen der
Konsortium-Mitglieder zurück.
Beschichten, Schleifen oder La-
sern werden derzeit getestet (Has-
ler: „Im Moment untersuchen wir
Belag und Stahl getrennt, weil es
messtechnisch einfacher ist.“). Zum
Einsatz kommt dabei das Tribome-
ter. Dieses Messgerät ist im ersten
„sportlichen“ K-Regio (2008 bis
2012) entstanden und ermöglicht
erstmals standardisierte Testungen
von Skiern im Labor. „Bei Stahl
heißt es etwa, je glatter, umso besser.
Es gibt aber auch Untersuchungen,
bei denen das nicht ganz zutrifft.
Daher wollen wir zuerst wissen, was
ist wirklich Fakt“, beschreibt Hasler
die Vorgehensweise. Derzeit wer-
den bei Tyrolit die ersten stähler-
nen Probekörper geschliffen, die
dann in verschiedenen Rauigkeiten
bei unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten und Temperaturen durch
das Tribometer gejagt werden, ähn-
lich wird dann bei den Belägen
vorgegangen. Hasler: „Auf diese
Art bekommen wir ein Basis-Know-
how für die Strukturen, vergleich-
bar werden wir bei den Beschich-
tungen arbeiten.“ Alle Erkenntnisse
zusammen sollen in einer neuar-
tigen Skiunterseite resultieren, die
einerseits den Projektmitgliedern
aus der Wirtschaft zugute kommt
(Marktvorsprung durch innovative
Skibearbeitungsmaschinen, Schleif-
mittel, Beläge), andererseits Millio-
nen von Sportbegeisterten ein bes-
seres, sichereres und genussvolleres
Skifahren ermöglicht. Infos unter:
www.tsa-tirol.com]
Mit mechatronischen Lösungsansätzen sucht das Technologiezentrum für Ski- und Alpinsport mit Partnern
aus der Wirtschaft nach einem schnellen Ski, dessen Kanten und Beläge so lange wie möglich halten.
Im eigens entwickelten Tribometer
arbeitet das Team rund um Michael
Hasler an einer innovativen Ober-
flächenbearbeitung von Skibelägen
und -kanten.
Eine bessere Performance
Foto: Mattro
Fotos: Lechner (1), Friedle (1)
Schicht auf Schicht
[ konkret GESEHEN ]
E
igentlich“, sagt der Physiker Georg
Strauss, „läuft heutzutage alles übers
Material und die Oberfläche. Schichten
als Verschleißschutz, damit sich z.B.
Werkzeuge nicht so schnell abnützen.
Schichten an der Oberflä-
che des Handys, damit die
Fingerabdrücke nicht so
stark sichtbar sind.“ Und
weil Schichten in Wirtschaft
und Industrie eine immer
größere Rolle spielen, wurde
im Herbst in Innsbruck das
Material Center Tyrol (MCT)
gegründet, um anwendungs-
orientierte Forschung im
Bereich der Materialtech-
nologie, der Oberflächen-
funktionalisierung und der
Dünnschichttechnologie zu
bieten. „Wir wollen uns als
Ansprechstelle für Materi-
altechnologie etablieren“, sagte MCT-
Leiter Strauss anlässlich des Starts – und
nur wenige Monate später kann er
schon auf Konkretes verweisen.
„Es ist zum Beispiel ZIMMER AUS-
TRIA, einer der weltweit führenden
Hersteller von digitalen Textil- und Tep-
pichdruckmaschinen mit Sitz in Kufstein,
an uns herangetreten“, berichtet Strauss.
Grund der Anfrage war eine Oberflä-
chenanalyse bei speziellen Ventilen. „Mit
der uns zur Verfügung stehenden Ana-
lytik konnten wir innerhalb von einem
Monat Lösungsansätze liefern, um das
Produkt zu verbessern“, sagt Strauss, für
den das MCT damit einen Teil seiner
Aufgabe – das universitäre Know-how
als Dienstleistung der Wirtschaft zur
Verfügung zu stellen – beweisen konnte.
Aber auch der zweite Teil – Forschungs-
kooperationen – ist schon auf Schiene.
Mit der Firma Sunplugged aus Mieming
wurde beim Land Tirol ein Kooperati-
onsprojekt eingereicht („Dabei geht es
um die Verbesserung des Dünnschicht-
prozesses für Photovoltaik-Strukturen.“),
mit CarbonCompetence wird zur Zeit
an einem FFG-Projektantrag gearbeitet.
„CarbonCompetence arbeitet mit Dia-
mantschichten für spezielle Werkzeuge.
Derzeit ist diese Schicht direkt auf
dem Hartmetall, was zu Verschleißer-
scheinungen führt. Notwendig ist aber
eine funktionelle Zwischenschicht, die
gewisse Diffusionseigenschaften verbes-
sert“, umschreibt Strauss das Projektvor-
haben. Wichtig für das MCT sei nun, so
Strauss, die notwendige Infrastruktur an
der Universität, damit man – sozusagen
Schicht auf Schicht – auch zu einem
physischen Zentrum wird.
MCT-Leiter Georg Strauss: „Schon drei Projekte seit
dem Start des Centers.“
„Es geht um die
Optimierung
der kompletten
Wertschöpfungskette.“
Gerald Schatz, Linz Center of Mechatronics
Foto: LCM
Foto: Friedle


















