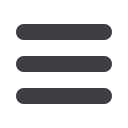
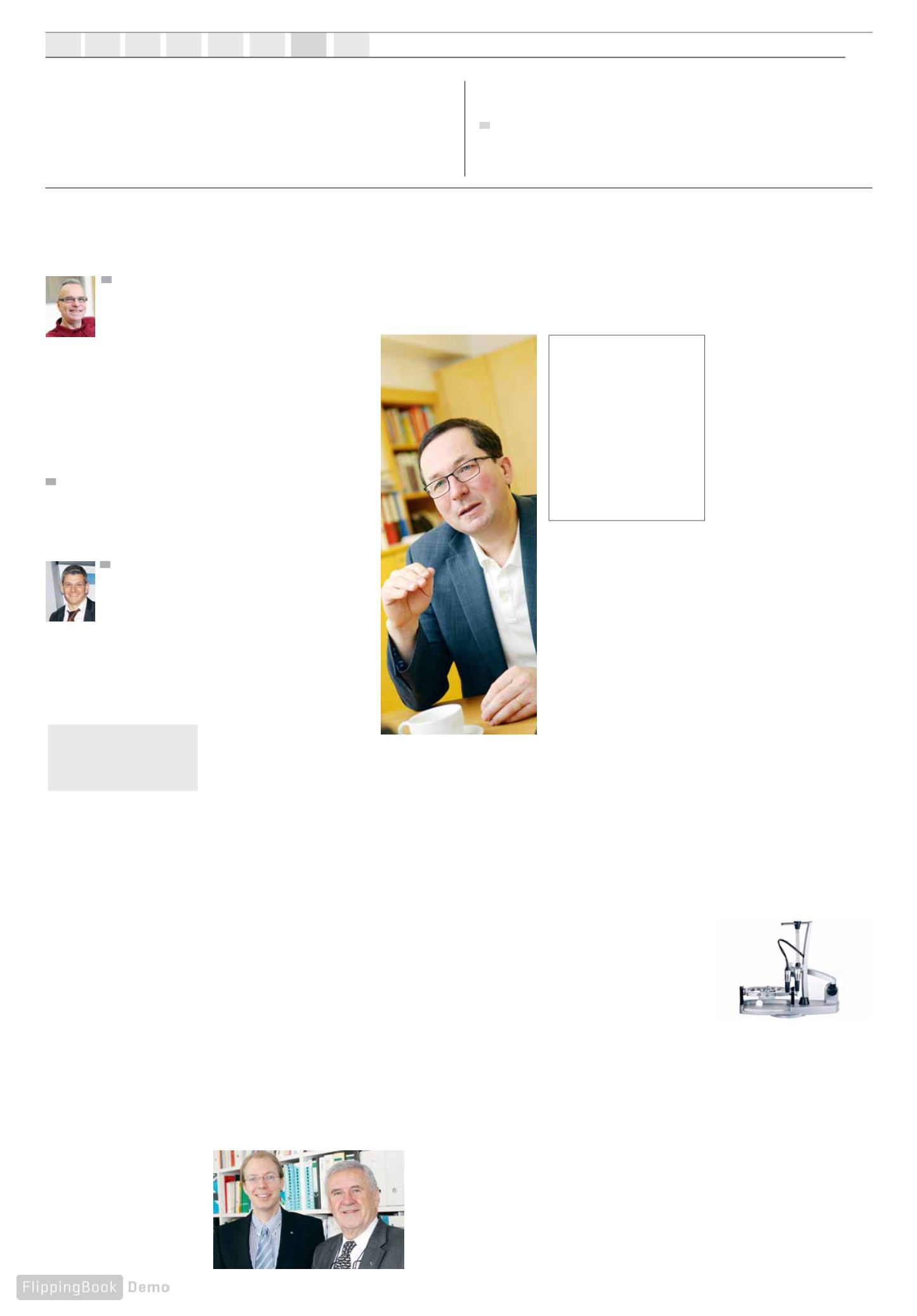
Das „Human Brain Pro-
ject“ wurde von der Europä-
ischen Kommission im neuen
Förderprogramm FET-Flagship
ausgewählt. Eine der daran be-
teiligten 80 Forschungsstätten
ist die Medizinuni Innsbruck. Das Projekt (Lauf-
zeit zehn Jahre, Dotation 1,19 Milliarden Euro)
soll das bestehende Wissen über das mensch-
liche Gehirn zusammenführen und das Gehirn
Stück für Stück auf Supercomputern in Modellen
und Simulationen nachbilden. Univ.-Prof. Dr.
Alois Saria (im Bild) ist im Managementbereich
des Konsortiums tätig. Er soll die Ausbildung von
bis zu 1000 PhD-Studierenden koordinieren,
Ausbildungsmodelle und Curricula entwickeln
sowie eine Fernstudienplattform aufbauen.
Der Tiroler Clusterpartner QMS Selle-
mond expandiert und hat in Wien eine neue
Niederlassung eröffnet: Das Unternehmen ist
auf die Bereiche Labor- und Qualitätsmanage-
ment sowie Reinraumplanung spezialisiert. Der
Bedarf dafür ist enorm – was die Expansion in
den Osten Österreichs erklärt.
Das pränatale Wachs-
tumsverhalten bei Kindern
von an Epilepsie erkrankten
Frauen stand im Fokus einer
Forschungsarbeit von ao.
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luef
(Univ.-Klinik für Neurologie) und Priv.-Doz.
Dr. Markus Rauchenzauner (Krankenhaus
St. Vinzenz in Zams). Für die im Journal of
Neurology publizierte Arbeit wurde Rauchen-
zauner (im Bild) mit dem Professor-Herbert-
Reisner-Preis ausgezeichnet.
3 2 1
4 5 6
7
8
0113
standort
Eine neue, europaweit einzigartige Welt des Hörens in Innsbruck
Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]
Nach eineinhalb Jahren Planung, Entwicklung der Exponate und Realisierung des Ausstellungskonzepts eröffnete im
Jänner das AUDIOVERSUM im Herzen von Innsbruck. Auf Initiative der Firma MED-EL wird in dem Erlebnis-Museum auf
interaktive Weise das Thema „Hören“ vermittelt. Im AUDIOVERSUM begibt man sich auf eine virtuelle Reise durch das
menschliche Ohr, entdeckt eine städtische Klanglandschaft und kann eine Hörbeeinträchtigung nachfühlen – all das auf über
1000 Quadratmetern Fläche. Infos unter
www.audioversum.atScience
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Life Sciences Tirol finden Sie auf
www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
F
lorian Kronenberg hat Haus-
tierchen, mehrere. Nur die
Namen, die der Mediziner
ihnen gegeben hat, sind etwas ei-
genartig. ApoA-IV nennt er eines.
Auch das ist schon ein Kosename,
denn eigentlich hört es auf Apolipo-
protein A-IV. Besonders handlich ist
es auch nicht, ist es doch mit freiem
Auge nicht sichtbar. Dafür ist es in-
teressant, sehr interessant sogar für
Kronenberg, Leiter der Sektion für
Genetische Epidemiologie an der
Medizinuni Innsbruck. Seit mehr
als einem Jahrzehnt beschäftigt er
sich mit ApoA-IV, unterstützt unter
anderem vom Land Tirol durch das
regionale Förderprogramm Trans-
lational Research (siehe Seite 2).
ApoA-IV wird fast ausschließlich
im menschlichen Darm gebildet
und in die Lymphe sezerniert. Be-
teiligt ist es unter anderem am
Cholesterin-Rücktransport von den
peripheren Zellen zur Leber oder
anderen Organen, wo Cholesterin
gebraucht wird. Funktioniert der
Rücktransport nicht, kommt es zu
einer Erhöhung des Cholesterin-
spiegels, was die Entstehung von
Arteriosklerose fördern kann. Zu-
dem dürfte ApoA-IV einen Einfluss
auf mehrere metabolische Prozesse
haben.
Im Jahr 2000 konnte Kronen-
bergs Team als erste Forschergrup-
pe weltweit einen Zusammenhang
zwischen niedrigen ApoA-IV-Kon-
zentrationen und koronarer Herz-
krankheit beim Menschen beschrei-
ben. 2006 sorgte eine weitere Tiroler
Studie für internationales Aufsehen.
Kronenberg: „Wir konnten damals
feststellen, dass eine Nierenfunkti-
onseinschränkung hohe ApoA-IV-
Werte verursacht und dass es zudem
ein Prädikator für den weiteren Ver-
lauf der Erkrankung ist.“
Seither hat Kronenberg ApoA-IV
noch genauer unter die Lupe ge-
nommen. „Wir hätten in den letzten
Jahren auch einige kleinere Publika-
tionen machen können. Wir wollen
aber ein ‚Global Picture‘ von ApoA-
IV“, sagt der Mediziner. Ende 2012
konnte er dann mit seinen Mitarbei-
terinnen Barbara Kollerits und Clau-
dia Lamina einen abgeschlossenen
Teil der ApoA-IV-Forschungen im
renommierten Journal of Internal
Medicine präsentieren und zeigen,
dass eine niedrigere Konzentration
von ApoA-IV bei Dialysepatienten
ein Prädikator für die Gesamtmor-
talität ist. Der nächste Schritt soll
nun die Identifikation der in die
Regulierung des ApoA-IV-Spiegels
involvierten Gene sein. Ermöglicht
wird dies durch den Zugriff auf aus-
gezeichnetes Datenmaterial. Neben
dem Material der Bruneck-Studie –
seit 1990 werden 1000 Einwohner
Brunecks im 5-Jahres-Rhythmus
untersucht – hat Kronenberg durch
internationale Kooperationen auf
Blut- und Serumproben mehrerer
Studien Zugriff. „Derzeit liegt die
Fallzahl bei 17.000 Probanden, jetzt
kommen aber noch Daten einer
Schweizer Studie mit weiteren 5000
Personen dazu. Und diese große
Fallzahl braucht es, um bei der Su-
che nach ‚neuen‘ Genen erfolgreich
zu sein“, sagt Kronenberg, Hinweise
auf ein bis zwei neben dem einen
bislang bekannten gebe es schon.
Und auch ein weiteres Feld scheint
sich zu öffnen – Ergebnisse einer
Zusammenarbeit mit einem Grazer
Kollegen deuten auf Zusammen-
hänge von ApoA-IV und den frei-
en Fettsäuren im Blutkreislauf hin.
Was Kronenberg überrascht hat –
obwohl er sein Haustierchen jetzt
schon lange kennt.
]
Foto: Friedle
Der Genetiker Florian Kronenberg beschäftigt sich schon lange mit dem Protein ApoA-IV und ist trotzdem
immer wieder überrascht, bei wie vielen Vorgängen im menschlichen Körper es beteiligt ist.
Global Picture statt Salamitaktik
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Life Science ]
Foto: Friedle
Foto: Teamword
Für eine Zukunft ohne Keime
Das Tiroler Unternehmen AMiSTec hat eine neue Technologie entwickelt, die
Oberflächen gegen die Besiedlung durch unerwünschte Mikroorganismen schützt.
Form und Funktion
MM Design in Bozen zeigt – gute Medizinprodukte
sind viel mehr als nur das technisch Machbare.
D
esign ist die Vereinigung
von Form und Funktion.
Vor allem ist Design aber
Ausdruck einer bestimmten Un-
ternehmensphilosophie bzw. be-
stimmter Unternehmenswerte. Dies
gilt auch oder vielleicht ganz beson-
ders für den Medizinbereich. „Ein
gutes Medizinprodukt trägt den
Ansprüchen verschiedenster Nutz-
ergruppen Rechnung“, erläutert Mi-
chael Scherer von MM Design und
ergänzt: „Gutes und konsequentes
Design muss vor allem den Wert
einer Marke kommunizierbar ma-
chen, also Werte wie Technologie,
Vertrauenswürdigkeit, Qualität und
Präzision vermitteln.“
Die Herausforderung, so Scherer,
liege in der Komplexität einer Viel-
zahl von Nutzeransprüchen. Arzt,
Pfleger, Techniker usw. wollen prak-
tische, sprich funktionale Geräte,
der Patient soll nicht mit angstein-
flößenden Geräten konfrontiert
werden, der Krankenhaus-Verwalter
setzt den Fokus auf die Kosteneffizi-
enz und Produktsicherheit und der
Hersteller will kostengünstig produ-
zieren. Von der Analyse des Nutzer
anspruchs bis hin zur Herstellung
eines funktionsreifen Prototypen
muss der Designprozess eine Viel-
zahl von Entwicklungsschritten be-
rücksichtigen. Daher ist der Gestal-
tungsprozess eines medizinischen
Geräts ein oft disziplinenübergrei-
fender Prozess, wo unterschiedliche
Kompetenzen gebündelt werden,
um den komplexen Anforderungen
gerecht zu werden.
MM Design, im Jahr 1991 gegrün-
det, ist ein Büro für strategische
Designberatung und Produktgestal-
tung. Das Gestaltungsumfeld des
Bozner Designbüros umfasst Pro-
dukte sowohl im Konsum- als auch
im Investitionsgüterbereich für Un-
ternehmen in Italien, der Schweiz,
Österreich und Deutschland. Infos
unter
www.mmdesign.eu]
Foto: MM Design
Zirkonfräse designed by MM Design
„Es gibt Hinweise auf ein, zwei weitere Gene,
die den ApoA-IV-Spiegel beeinflussen.“
Florian Kronenberg, Sektion für Genetische Epidemiologie der Medizinuni Innsbruck
Florian Kronenberg
Der Oberösterreicher studierte von
1981 bis 1989 in Innsbruck Medizin.
Nach dem Studium war er bis 1997
am Institut für Medizinische Biologie
und Humangenetik der Uni Inns-
bruck tätig. Danach folgten ein zwei-
jähriger Aufenthalt an der University
of Utah, die Habilitation im Jahr 2000
sowie zwei Jahre als Forschungsleiter
am Helmholtz Zentrum in München.
Seit 2004 ist Kronenberg Professor
für Genetische Epidemiologie an der
Medizinuni Innsbruck.
M
ikroorganismen wie Bak-
terien und Pilze findet
man auf fast allen unbe-
lebten Oberflächen. Besonders in
Spitälern werden sie dabei mehr
und mehr zur Gefahr, da es inzwi-
schen viele resistente Keime gibt.
Eine neue, weltweit einzigartige
Lösung für dieses Problem hat die
AMiSTec in Kössen entwickelt. Dem
Team um Peter Guggenbichler und
Maximilian Lackner gelang es, erst-
mals inhärent und dauerhaft keim-
freie Oberflächen herzustellen.
Vorbild für die AMiSTec-Techno-
logie ist der natürliche Säureschutz-
mantel der menschlichen Haut.
Dazu Peter Guggenbichler: „Bei äl-
teren Verfahren, wie zum Beispiel in
Materialien eingearbeitetes Nano-
Silber, gab es den Nachteil, dass die
Wirksamkeit mit der Zeit nachließ.
Bei unserer Technologie ist das nicht
der Fall.“ Bei der AMiSTec-Methode
werden spezielle Übergangsmetall-
verbindungen in Kunststoffe einge-
bracht. Kommen sie mit Wasser in
Berührung, bilden sich protonierte
Wassermoleküle (H
3
O+Ionen, be-
kannt als Oxoniumionen), die die
Proteinstrukturen der Keime zer-
stören und zum Absterben führen.
„Wir können inzwischen nahezu
alle Kunststoffe keimresistent ma-
chen“, betont Lackner und ergänzt:
„Die Materialsysteme und Produkte,
die wir mit unseren Kunden entwi-
ckeln, kann man mit einem Tuch
und einem Reiniger abputzen und
die wenigen Keime, die vielleicht
noch anhaften, sterben nach kurzer
Zeit ab. Aber auch wenn man nicht
wischt, sterben die Keime innerhalb
weniger Stunden ab.“ Und auch
Farben, Lacke und Silikon können
mit der neuen Technologie keim-
resistent gemacht werden. Das er-
öffnet ein weites Anwendungsfeld:
Medizin, öffentlicher Verkehr und
Industrie, Anstriche, Verpackungen
– nicht zuletzt auch in der Lebens-
mittelindustrie.
Im AKH in Wien läuft derzeit ein
Feldversuch und in Graz werden die
Halteschlaufen einer Straßenbahn
mit antimikrobieller Beschichtung
getestet. In Österreich, China und
Deutschland hat AMiSTec inzwi-
schen Lizenznehmer, beispielsweise
für Kabel und Epoxidharz, das für
Bodenbeschichtungen verwendet
wird. Damit werden Schlachthöfe
oder milchverarbeitende Betriebe
ausgestattet, um dort das Infekti-
onsrisiko zu reduzieren, aber auch
um den Einsatz von zum Teil nicht
ungiftigen chemischen Reinigungs-
mitteln zu senken. Die AMiSTec-
Technologie erlaubt es den Li-
zenznehmern und deren
Kunden, Kosten, Reini-
gungsmittel und Energie zu
sparen.
Die Technologie selbst
ruft keine Resistenzen her-
vor und nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt
gibt es ebenfalls nicht, da
die eingesetzten Stoffe
nicht toxisch sind. Infos un-
ter
www.amistec.at]
Foto: Huber
Dr. Maximilian Lackner, Dr. Peter Guggenbichler (v.li.)


















