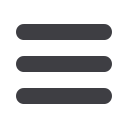
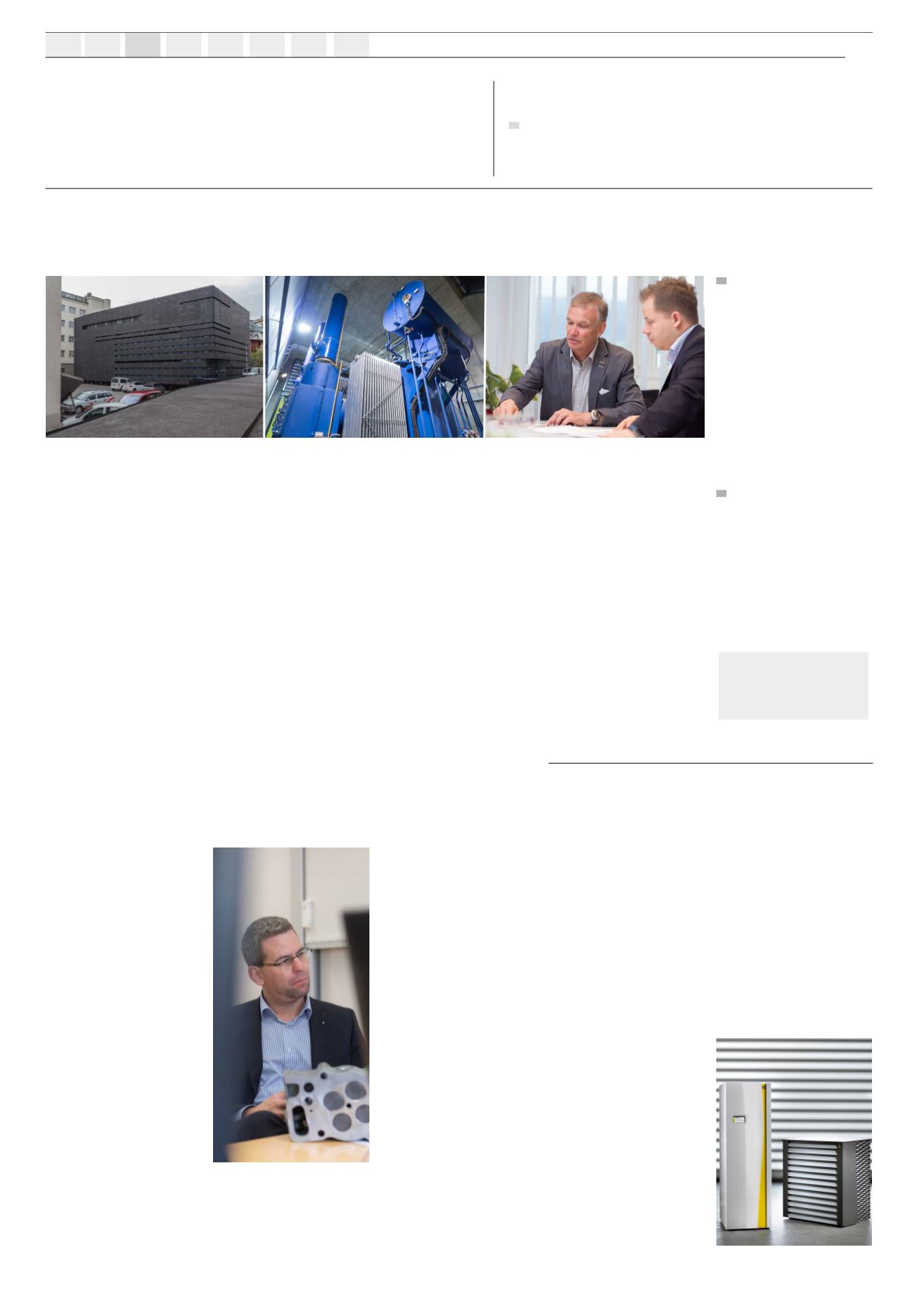
Fotos:Andreas Friedle
3
2 1
4 5 6 7 8
0217
STANDORT
Thema: [ ERNEUERBARE ENERGIENTIROL ]
Seit fünf Jahren bewertet GLOBAL 2000 die österreichischen Stromanbieter anhand von drei
Kriterien (100 Prozent Erneuerbare Energie aus Österreich; Unabhängigkeit von fossilen und ato-
maren Anbietern; ein Beitrag zur Energiewende muss gegeben sein) und empfiehlt auf dieser Basis
Anbieter.Von den 117 Grünstromanbietern in Österreich entsprechen aber nur drei den GLOBAL
2000-Kriterien: die StadtwerkeWörgl, die Alpen Adria Energie und dieWEBWindenergie AG.
ENERGIE
StadtwerkeWörgl: unabhängig und völlig erneuerbar
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Erneuerbare Energien Tirol finden Sie
aufwww.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Energie ]
Das deutsche CleanTech Institut und
EuPD-Research haben im Auftrag des
Wirtschaftsmagazins TREND den ersten
Vergleich von Stromspeichern in Österreich
durchgeführt. Dabei wurden technische
Leistungsdaten dem Preis gegenübergestellt,
um den „TOP-Stromspeicher Österreichs“
zu ermitteln. Der Hochleistungs-Stromspei-
cher Garabat 4.2 des Tiroler Unternehmens
Garamanta überzeugte die Jury – trotz
deutlich höherem Preis gegenüber den
Mitbewerbern – und wurde mit dem Prä-
dikat GOLD zum besten österreichischen
Stromspeicher ausgezeichnet. Garamanta
setzt auf eine eigenständige Systemarchi-
tektur, zum Einsatz kommen aufwendige,
nicht brennbare Lithium-Polymer-Zellen, die
besonders sicher und leistungsfähig sind.
Im Dezember 2016 wurden in Inns-
bruck von der Neuen Heimat Tirol 145
Wohnungen in der neuen Anlage Pradl Ost
(ehemalige SüdtirolersiedlungTüringstraße/
Gumppstraße) übergeben, einTiefgaragen-
Stellplatz ist für ein „hauseigenes“ E-
Carsharing Auto reserviert. Dieses kann
von allen Parteien angemietet und genutzt
werden. Das Projekt „schont die Umwelt
und ist gut für die Geldbörse“, hat einen
hohen sozialen Aspekt und fand in der
NHT-Wohnanlage Riedmannareal in Kundl
im Februar schon einen Nachfolger.
W
ohl so mancher Fußgän-
ger, der von der Salurner
Straße die Notburga-Klam-
mer-Gasse Richtung Heiliggeiststraße
geschlendert ist, mag sich gefragt ha-
ben, was sich hinter demmeterhohen
und -langen Quader aus schwarzem
Basalt verbirgt. Das Umspannwerk
Mitte, das die Stromversorgung der
Innsbrucker Innenstadt sichert, war
bislang die Antwort, seit Kurzem kann
sie mit „Und zudem die Heizung des
IKB-Gebäudes“ ergänzt werden.
„Die grundsätzliche Idee, beste-
hende Infrastruktur für andere Zwe-
cke mitzubenutzen, besteht schon
seit Längerem“, sagt Marco Casotti,
Leiter des Innovationsmanagements
bei der IKB. Prinzipiell ins Auge
fasste man dabei die Abwärmenut-
zung der unternehmenseigenen
Trafoanlagen, konkret jene des Um-
spannwerks Mitte, „als die Heizung
in der IKB-Zentrale am Ende ihrer
Lebensdauer war“, erzählt Bernhard
Hupfauf,
IKB-Geschäftsbereichs-
leiter Zentrale Services. Passend zu
den Zielen des EU-Projekts SINFO-
NIA, in Innsbruck und Bozen durch
hochqualitative Sanierungen und
innovative Energiekonzepte den
Energiebedarf um 50 Prozent und
den CO
2
-Ausstoß um 20 Prozent zu
senken sowie den Anteil an erneu-
erbaren Energien um 30 Prozent zu
heben, überlegte man, wie man in
Zukunft statt zu 100 Prozent mit Gas
auch mit Abwärme heizen könnte.
„Wir überlegten, den Ölkreis, der
den Trafo kühlt, anzuzapfen und
diese Wärme zu nutzen“, erinnert
sich Casotti – was sich als schwer,
wenn überhaupt umsetzbar heraus-
stellte. Die nächste Idee, nämlich die
Abstrahlwärme des Trafos aus der
Raumluft „einzufangen“ und mit-
tels Luft-Wasser-Wärmepumpe als
„Heizmittel“ zu verwenden, war aber
umsetzbar. Man habe sogar noch
eins „draufgesetzt“, lacht Casotti,
und beziehe die Umweltwärme der
Außenluft mit ein. Notwendig war
dafür eine intelligente Steuerung
der Jalousieklappen im Traforaum,
über welche die Luftströme zwischen
Außenluft und Trafoabwärme ge-
steuert werden. „Voraussetzung war
natürlich der gesicherte Betrieb des
Trafos, keine Überhitzung und kei-
ne Effizienzverluste. Diese Heraus-
forderungen haben wir erfolgreich
gemeistert. Dabei hat uns die gute
Zusammenarbeit mit dem Strombe-
reich genützt“, berichtet Hupfauf.
Zwei Monitoring-Monate hat die
neue Heizung hinter sich, 80 Pro-
zent des Heizbedarfs in der IKB-Zen-
trale wurden von der Wärmepumpe
abgedeckt (Hupfauf: „Ursprünglich
dachten wir an 50 Prozent.“).
Im Prinzip, so Hupfauf und Casot-
ti, sei das Modell auch mit anderen
Trafoanlagen umsetzbar, notwendig
wären aber sicherlich ein Abnehmer
in der Nähe eines Umspannwerks
und die Verfügungsgewalt über die
Trafos. Für die IKB ist das „Heizen
mit Abwärme“-Projekt ein weiteres
Vorhaben, das neben dem Austausch
der Blockheizkraftwerke und der Er-
richtung des neuen Holzkraftwerks
am Areal der Kläranlage in der Ro-
ßau im Rahmen von SINFONIA um-
gesetzt wurde. Im Entstehen ist nun
ein Smart-District in der Roßau: Am
dortigen IKB-Areal werden alle Ge-
bäude strom- und wärmetechnisch
intelligent vernetzt. Info
www.ikb.at]
Wärmepumpen mit IQ
[ konkret GESEHEN ]
D
ie Effizienz einer Wärmepumpe
zu verbessern, ist mit einem
großen Kosteneinsatz verbunden.
Trotzdem wird sich in Zukunft
noch was tun“, ist Christoph Bacher,
Entwicklungsleiter beimWärme-
pumpen-Spezialisten iDM, überzeugt,
er stellt aber auch fest: „Es gibt
wesentlich größere Potenziale, um
Kosten zu sparen und das System zu
optimieren.“ Schon seit einigen Jah-
ren haben die Osttiroler etwa eine
ausgeklügelte Einzelraumregelung im
Programm. „Normalerweise misst
ein Raumthermostat die Temperatur.
Ist es zu warm, schaltet sich die Hei-
zung aus, ist es zu kalt, schaltet sich
die Heizung ein – egal, was dieWär-
mepumpe im Keller gerade macht.“
Bei iDM übernehmen Tempera-
tursensoren diese Aufgabe, zudem
„denkt“ dieWärmepumpe dank Da-
tenvernetzung mit. So werden etwa
Wetterprognosen berücksichtigt,
um eine Überhitzung der Räume an
sonnigen Tagen oder eine Abkühlung
bei Wetterumschwüngen zu vermei-
den. DieWärmepumpe achtet auch
auf die Charakteristik des Raumes.
Bacher: „Manche Räume brauchen
z.B. länger, um warm zu werden,
andere werden schneller kalt.“ Seit
drei Jahren hat man bei iDM die
Wärmepumpe auch intelligent mit
der Photovoltaikanlage verknüpft
und nützt den hauseigenen Strom,
wenn er im Überschuss da ist.
Zusätzlich gibt es seit letztem Jahr
auch eine Kooperation mit einem
Stromanbieter. „Das österreichische
Start-up aWATTar ist der erste An-
bieter, der stundenvariable Tarife an-
bietet“, erklärt der iDM-Mitarbeiter.
Jeden Tag erhält man um 14.00
Uhr die Tarifwerte für die nächsten
24 Stunden. Mit diesemWissen
wird dieWarmwasserheizung sowie
Raumheizung bzw. -kühlung gesteu-
ert. Der Kunde muss sich über die
iDM-Homepage registrieren und an-
melden, den Stromanbieterwechsel
macht iDM. Nach einem Software-
Update (Bacher: „Für alle Modelle
seit 2009 möglich.“) profitiert der
Kunde vom günstigsten Stromtarif,
zudem steigt der Verbrauchsanteil an
Strom aus erneuerbaren Energien.
Infos auf
www.idm-energie.at]
E
s war ein langer Weg für Lu-
kas Möltner: Lehre, Meis
terprüfung,
Abendschule,
Fachhochschule, Universität. Was
ihn die ganze Zeit begleitete, vom
Automechaniker bis hin zum Fach-
bereichsleiter
Verfahrenstechnik
am MCI, war die Beschäftigung mit
Motoren, anfangs reparierend, heu-
te optimierend. Im Projekt HiGas
etwa nahm er mit seinen Mitarbei-
tern einen Gasmotor des unteren
Leistungsbereichs ins Visier – und
erzielte eine Effizienzsteigerung von
1,6 Prozent. Was wenig klingt, fasst
der Forscher in andere Zahlen: „Bei
8000 Jahresbetriebsstunden heißt das
eine Reduzierung des CO
2
-Ausstoßes
um 3,7 Tonnen, für den Betreiber
eines mit solchen 150-kW-Motoren
ausgestatteten Blockheizkraftwerks
bedeutet es 3000 bis 4000 Euro mehr
im Jahr.“
Erreicht wurde die Effizienzstei-
gerung des Motors durch eine Be-
schleunigung der Verbrennung.
Initiiert an der Zündkerze, pflanzt
sich die Verbrennung in den Brenn-
raum fort, je schneller, desto höher
die Arbeitstemperaturen und der
Wirkungsgrad. Die Geschwindigkeit
wiederum hängt davon ab, wie sich
frisches Gas mit Abgas vermischt.
„Diese Vermischung optimieren wir,
indem wir im Brennraum Turbu-
lenzen generieren. Und das führt in
Folge zu einer schnelleren Verbren-
nung“, berichtet Möltner. Die Kon-
zentration des MCI-Teams gilt dabei
der sogenannten Drallströmung, „die
beeinflussen wir durch speziell ge-
formte Ventilsitze am Zylinderkopf.“
Nach numerischen Simulationsme-
thoden wurden mit den vielverspre-
chendsten Modellen mittels Rapid
Prototyping Zylinderköpfe herge-
stellt. Im Labor-Prüfstand wurden an-
schließend Durchströmungsversuche
durchgeführt, „mit Geometrien, die
uns zufriedengestellt haben, ließen
wir echte Zylinderköpfe fertigen“.
Mit diesen ging‘s dann in einen
Versuchsmotor eines Blockheizkraft-
werks der Stadtwerke Schwaz, um
den Zylinderkopf im Echtbetrieb zu
testen.
Die Zylinder aus dem – über Inno-
vationsförderungen des Landes Ti-
rol mitfinanzierten – HiGas-Projekt
werden in Kooperation mit dem
Schwazer Gasmotoren-Spezialisten
ECI schon verkauft und ausgeliefert,
auch alte Motoren können nach-
gerüstet werden. Im Folgeprojekt
Opticom möchte Möltner testen, ob
noch weitere Effizienzsteigerungen
möglich sind. Ein schmaler Grat,
meint der Wissenschaftler, denn be-
schleunige man die Drallströmung
noch mehr, könnten zu hohe Wand-
wärmeverluste zu einem schlechteren
Wirkungsgrad führen. Doch auch an-
dere mögliche Störfaktoren gilt es zu
berücksichtigen, so kann etwa eine zu
schnelle Verbrennung den Zündker-
zen Schwierigkeiten bereiten. „Das
ist ein Alleinstellungsmerkmal un-
serer Gruppe“, betont Möltner, „wir
beschäftigen uns mit der gesamten
Prozesskette Zündung-Verbrennung-
Emission.“ Info:
www.mci.edu]
Lukas Möltner: „Wir erreichen eine
Effizienzsteigerung von 1,6 Prozent.“
Turbulente Verbrennung
Motoren begleiten Lukas Möltner seit seinem 16. Lebensjahr. Am MCI widmet
er sich Gasmotoren, um aus ihnen noch mehr Effizienz herauszukitzeln.
Foto:Andreas Friedle
Foto: iDM
SINFONIA:
Sehr viel mehr als heiße Luft
Umspannwerk Mitte: Kühl designte Hülle und heißer Kern, unter Koordination der IKB-Mitarbeiter Bernhard Hupfauf und Marco Casotti
(v.li.) zur Heizung „ausgebaut“.
Das neue Design von iDM – passend
zum 40. Geburtstag – wurde mit dem
Red Dot Award ausgezeichnet.
















