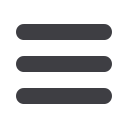

3 2 1
4 5 6
7
8
0217
STANDORT
V
or rund zehn Jahren war die
Überlegung, dass Krebs eine
Immunerkrankung ist, noch
sehr umstritten, weiß der Innsbru-
cker Forscher Gottfried Baier, „als
Immunonkologe bin ich noch belä-
chelt worden“. Bahnbrechende Er-
folge erster Immuntherapien (Baier:
„Mit ihnen gelang es erstmals, un-
heilbare Lungenkrebserkrankungen
zu kontrollierten Erkrankungen zu
machen.“) führten zu einem Um-
denken, auch wenn diese ersten
Therapien, die eine Reaktivierung
des schützenden Immunsystems be-
wirken, noch limitierte sind. „Erstens
sprechen nur wenige der Patienten
darauf an, von diesen wiederum spre-
chen manche zu gut, sprich mit Au-
toimmunsyptomen an, was einen Be-
handlungsabbruch erzwingen kann.
Und drittens sind Krebsimmunthe-
rapien mit diesen biotechnologisch
hergestellten Biologicals extrem teu-
er, ein Gramm der Substanz kostet
das Tausendfache von Gold“, erklärt
der Direktor der Sektion für Trans-
lationale Zellgenetik an der Medi-
zinischen Universität Innsbruck.
Baier möchte daher einen anderen
Weg gehen, an dessen Ziel, so des
Forschers Traum, „eine Pille gegen
Metastasen“ stehen könnte. Errei-
chen will Baier dies mit dem Zielmo-
lekül NR2F6, einem intrazellulären
Immun-Checkpoint, mit dem die
Immunabwehr gezielt im Tumor ak-
tiviert werden kann. Tatkräftige und
finanzielle Unterstützung erhält der
gebürtige Vorarlberger dabei vom
japanischen Big-Pharma-Unterneh-
men Daiichi Sankyo (Umsatz 2015
über sieben Milliarden Euro).
Den europäischen Big-Pharma-
Partnern war Baiers Idee, ein völlig
neuartiges Krebsmedikament zu
entwickeln, das NR2F6 pharmakolo-
gisch hemmen kann, zu riskant. „Die
Japaner sagten: Sounds good to us“,
erklärt Baier, geprüft „und im Labor
in Tokio nachgekocht“ wurden seine
Forschungsergebnisse zu NR2F6 den-
noch – und überzeugten. Eine erste
finanzielle Förderung erhielt Baier,
um zu zeigen, dass die Erkenntnisse
aus dem Mausmodell im Labor auch
auf menschliches Tumorgewebe zu-
treffen: „Das ist uns gelungen.“ Da-
nach checkte Daiichi Sankyo seine
zwei Millionen Substanzen umfas-
sende Sammlung nach passenden
und
nicht-patentierten
NR2F6-
Hemmstoffen – und wurde fündig.
„Der nächste und aufwendige
Schritt ist die chemische Optimie-
rung der vielversprechendsten Sub-
stanzen und dann die finale Auswahl
des Arzneimittelkandidaten“, sagt
Baier, In den nächsten zwei Jahren,
ist er optimistisch, sollte sich zeigen,
„ob wir die erste Ziellinie, den Start in
die klinischen Phasen I und II errei-
chen können.“ Unterstützung findet
er dabei in seinem neuen Christian-
Doppler-Labor. Rund 2,2 Millionen
Euro stehen Baier für die weiterfüh-
rende Forschung an NR2F6 in den
nächsten sieben Jahren zur Verfü-
gung, Mit diesem Schritt habe er,
lacht der 54-Jährige, das komfortable
Laborleben verlassen und sich in ei-
nen Bereich begeben, „in dem man
akademisch auch leicht abstürzen
kann.“ Voraussetzungen fürs „Oben-
bleiben“ bringt Baier jedenfalls mit:
Als Bergsteiger war er u.a. im Hima-
laya am Gipfel des 7161 Meter hohen
Pumori. ]
Gottfried Baier sucht mit einem Big-
Pharma-Partner aus Japan nach einem
revolutionierenden Krebsmedikament.
Foto:Andreas Friedle
Innovation mit Absturzgefahr
Im CD-Labor für pharmakologische Krebsimmuntherapie geht Gottfried Baier den
„österreichischen Weg“, der sich auf intrazelluläre Immun-Checkpoints fokussiert.
VASCage erhält ausgezeichnete Kritiken zur Projekthalbzeit
Seit 2014 läuft im Rahmen von COMET das K-Projekt VASCage (Research Center of Excellence in
Vascular AgeingTyrol). Geleitet von der Medizinuni Innsbruck werden die altersbedingtenVeränderungen in
der Gefäßwand – beginnend von erstenVeränderungen im Jugendalter bis hin zu den typischen Pathologien
des höheren Lebensalters – erforscht. Laut einer aktuellen Zwischenbilanz entstanden seither 30 hochkarätige
Arbeiten inTop-Journalen, die teilweise in die Entwicklung neuer Diagnostika undTherapien münden werden.
SCIENCE
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Life SciencesTirol finden Sie auf
www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Life Science ]
Der in der Ukraine
geborene Taras Valovka
beschrieb im Fachjournal
PNAS erstmals einen
neuen Mechanismus im
Zusammenhang mit der
Regulation von Entzündungsgenen und
liefert damit einen Angriffspunkt für die
Entwicklung innovativer Therapieoptionen
bei Autoimmunerkrankungen und Krebs.
Der Forscher an der Sektion für Neuro-
anatomie der Medizinischen Universität
Innsbruck wurde für diese Arbeit mit
dem Preis des Fürstentums Liechtenstein
ausgezeichnet.
Zwei Forscher der
Innsbrucker Universitätskli-
nik für Neurologie wurde
vor Kurzem von der Tiroler
Ärztekammer für ihre
Leistungen ausgezeichnet.
Gregor Wenning (im Bild) befasst sich
seit mehr als zwei Jahrzehnten mit den
Ursachen, demVerlauf und der Therapie
der progressiven neurodegenerativen
Multisystematrophie und erhielt dafür den
Dr.-Johannes-Tuba-Preis. An Philipp Mahl-
knecht ging der Förderungspreis für junge
ärztlicheWissenschafterInnen aufgrund
seiner Arbeiten zur idiopathischen REM-
Schlaf-Verhaltensstörung.
Foto:Uni Innsbruck
Foto:MUI
Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]
T
raditionelle Biotechnologie
findet im 2000-Liter-Bereich
statt“, weiß der gelernte Che-
mielaborant und MCI-Absolvent Jo-
hannes Kirchmair, „die Reinigung
dieser Anlagen ist sehr kompliziert,
weil darauf geachtet wird, dass da-
nach alles wieder steril ist und nicht
einmal ein Pikogramm der vorigen
Substanz in den Behältern zurück-
bleibt.“ Die zeit- und kostengünstige
Lösung sind große Einwegsäcke aus
Kunststoff im Inneren des Tanks,
nach genauen Vorgaben produzierte
Single-Use-Produkte. Doch nicht nur
in großen Bioreaktoren kommen
Single-Use-Systeme zum Einsatz, für
Forschungszwecke etwa werden viel
kleinere Mengen benötigt, ein flexi-
bles Produzieren ist dafür notwendig.
Auch am Ende der Produktion be-
steht Bedarf an Single-Use-Bags. „Das
Ergebnis einer Produktion sind z.B.
200 Liter einer hochkonzentrierten
Lösung für ein Krebsmedikament.
Die wird in Beutel mit einem Volu-
men vom fünf Liter abgefüllt, gelagert
und transportiert“, erklärt Kirchmair.
Es stellt sich die Frage der Sicherheit:
War der Single-Use-Bag vor der Befül-
lung auch wirklich dicht? Durch ein
noch so kleines Loch könnten Ver-
unreinigungen in den Bag gelangen,
ein potenzielles Risiko für Patienten.
Auf der anderen Seite könnte die
hochkonzentrierte Substanz durch
ein Loch austreten, ein potenzielles
Risiko für die Umwelt.
„Es gibt noch keine Technologie,
die im Reinraum die hundertpro-
zentige Dichtheit eines Single-Use-
Bags garantiert“, nennen Kirchmair
und Wirtschaftsingenieur Thomas
Wurm die Marktlücke, die sie mit ih-
rem 2016 in Kirchbichl gegründeten
Unternehmen Single Use Support
schließen wollen. Dabei setzen sie
auf Helium und Vakuum. Aufgrund
seiner chemischen Eigenschaften
eignet sich Helium als Tracer-Gas,
um Kleinstlecks aufzuspüren. Da es
in der Umgebungsluft auch nur in
ganz geringen Mengen vorkommt,
ist eine erhöhte Konzentration zu-
dem leicht messbar. „Es gibt schon
Dichtheitsmessungen mit Helium“,
erzählt Wurm, der Nachteil sei nur,
dass dabei der Bag stark aufgebläht
wird, der Prüfling bei der Prüfung so-
zusagen geschädigt wird. Nicht so bei
der SUS-Innovation. Zur Messung
im Reinraum kommt der Bag, an
den schon bei der Herstellung eine
Art Heliumkartusche befestigt wird,
in einen Behälter, wird auf ein Vlies
gebettet und mit einer Kunststoffhül-
le umgeben. Dann wird ein Vakuum
gezogen und der Bag mit Helium
gefüllt, ein im Gerät integriertes Mas-
senspektrometer misst einen mög-
lichen Heliumaustritt.
Das Alphagerät ist derzeit bei
einem Kunden im Probeeinsatz, mit
zwei Pharmagrößen bestehen Ver-
träge, um das Gerät zur Marktreife
zu bringen. Die Beta-Variante ist für
September eingeplant, gefördert von
aws und FFG. „Optisch fertig und
mit angeschlossener Software“ ist das
Ziel, drei, vier Partner sind als Tester
fürs Finetuning angepeilt, Frühling
2018, so der ambitionierte Plan, sol-
len die ersten Kunden beliefert wer-
den. Info:
www.susupport.com]
Das Kirchbichler Start-up Single Use Support hat Big Pharma im Visier. Sein innovatives Verfahren
garantiert die Dichtheit von Einweg-Kunststoffbeuteln, die in der Pharmaindustrie immer wichtiger werden.
Perfekte Dichtheitskontrolle
Foto:Andreas Friedle
ThomasWurm und Johannes Kirchmair
(v.li.) setzen auf Helium undVakuum, um im Reinraum Single-Use-Systeme zu prüfen.
[ konkret GEFRAGT ]
Ein EU-Portal für alle Studien
S
eit 2006 bietet das Koordinie-
rungszentrum für klinischen
Studien (KKS) eine kostenlose Ba-
sisberatung für universitäre und au-
ßeruniversitäre klinische Forschungs-
projekte in Tirol. Ende 2018 soll die
neue Clinical Trial Regulation der EU
starten. Diese bringt eine Reihe von
Änderungen für klinische Studien im
Arzneimittelbereich mit sich – welche,
erklärt Sabine Embacher, Leiterin des
KKS an der Mediziniuni Innsbruck:
SABINE EMBACHER
:
In Zukunft
gibt es für alle Studien nur mehr eine
Einreichung über ein EU-Portal. Man
wählt ein Land als Reporting Mem-
ber State und weitere als Concerned
Member States dazu. Die Studie wird
dann für das Genehmigungsverfahren
in diesen Ländern verteilt, die Kom-
munikation läuft über dieses Portal.
STANDORT:
Das klingt nach einer
bürokratischenVereinfachung.
EMBACHER
:
Auf dieser Ebene. Nati-
onale Unterlagen für länderspezifische
Unterschiede muss man weiterhin
über das Portal hochladen. Weniger
Dokumente werden es nicht.
STANDORT:
Gibt es Fristen?
EMBACHER
:
Es gibt sehr strikte und
enge Zeitlinien, sowohl für die Einrei-
cher als auch für die Behörden, die
mit Unterstützung der Ethikkommissi-
onen die Anträge begutachten – z.B.
zehn Kalendertage für die gesamte
Validierung der Unterlagen.
STANDORT:
Der Antragsteller weiß,
bis wann er eine Antwort bekommt?
EMBACHER
:
Ja, aber auch für Nach-
reichungen bleibt wenig Zeit, aufschie-
bende Bedingungen gibt es nicht mehr.
STANDORT:
Bis zur Entscheidung
„darf durchgeführt werden oder
nicht“ vergehen maximal 106Tage.
EMBACHER
:
Ja. Wenn die Zeitlinien
ohne Entscheidung verstreichen, ist
die Studie wie eingereicht akzeptiert.
STANDORT:
Was heißt das für Ein-
reicher?
EMBACHER
:
Die Unterlagen sollten
zu Beginn komplett sein. Daher infor-
mieren wir und wollen Schulungsun-
terlagen und Manuals zusammenstel-
len.Wir könnten auch das Einreichen
selbst übernehmen – da stellt sich
aber die Frage, wer es zahlt.
STANDORT:
Gibt es sonst noch Än-
derungen?
EMBACHER
:
Alle Informationen sind
public by default. Beim Einreichen muss
festgelegt werden, unter welche Ver-
traulichkeitsstufe welches Dokument
fällt – wenn nicht, ist es öffentlich.
Sabine Embacher: „Strikte Zeitlinien.“
Foto:Andreas Friedle
















