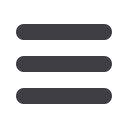
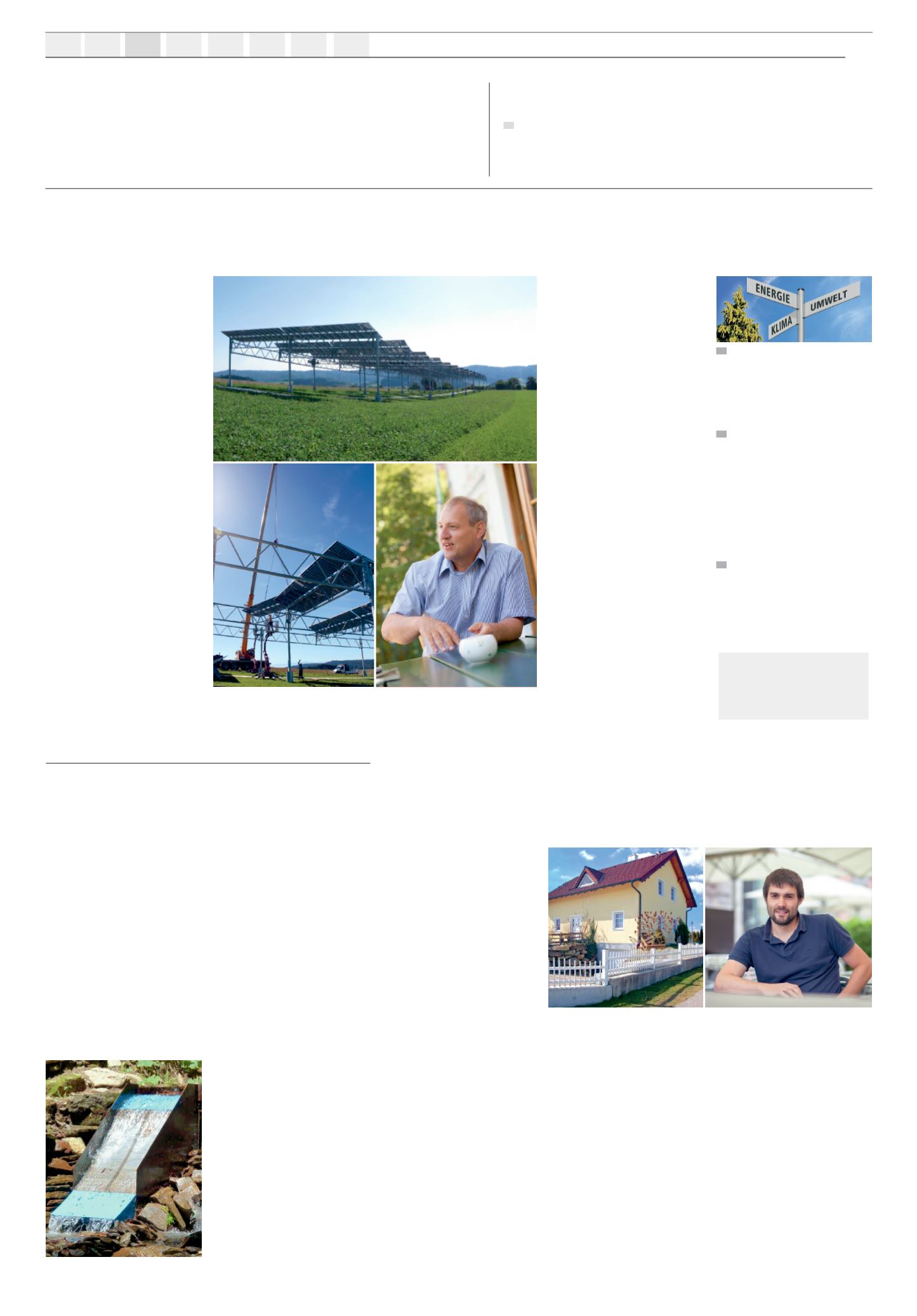
Fotos:Andreas Friedle (1),Fraunhofer (2)
3
2 1
4 5 6 7 8
0317
STANDORT
Thema: [ ERNEUERBARE ENERGIENTIROL ]
„Wissen kompakt“ ist die umfassende Daten- und Faktensammlung des Klima- und Energiefonds
zumThema Energie und Klimaschutz in Österreich.Vor knapp fünf Jahren erstmals als Nachschla-
gewerk erstellt, bietet es nun auf mehr als 180 Seiten aktuelle Informationen zu Technologien und
Marktdaten sowie internationalen Vorgaben, nationalen Plänen und globalen Energieentwicklungen.
Das aktualisierte Nachschlagewerk gibt‘s zum Gratis-Download auf
www.klimafonds.gv.atENERGIE
180 Seiten Know-how rund um Klimaschutz, Energie und Mobilität
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Erneuerbare Energien Tirol finden Sie
aufwww.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Energie ]
„Wegweiser Energie- und Umweltför-
derungen“ nennt sich eine Informationsbro-
schüre für Klein- und Mittelunternehmen
des bmwfw, die maßgebliche Förderungs-
und Beratungsangebote des Bundes, der
Länder und der EU zusammenfasst. Down-
load der Broschüre auf
www.bmwfw.gv.at.
Im Juni beschloss der Nationalrat die
kleine Ökostromnovelle. Das Novellenpaket
beinhaltet eine Reihe von Gesetzesände-
rungen: 2018 und 2019 gibt‘s im Bereich
der Photovoltaik einen neuen 30-Millio-
nen-Euro-Fördertopf für Investitionen in
Anlagen und Speicher; 2017 und 2018
eine Sonderförderung für Kleinwasserkraft
(3,5 Millionen); und für Biogasanlagen der
zweiten Generation jährlich 11,7 Millionen
für fünf Jahre.
iDM Energiesysteme, Clustermitglied
aus Matrei in Osttirol, feierte vor Kurzem
das vierzigjährige Firmenjubiläum. iDM
(Umsatz 2016 ca. 30 Millionen Euro) ist
mit jährlich rund 5000Wärmepumpen der
führende Hersteller von Heizungswärme-
pumpen in Österreich.
E
s sind gerade mal 0,4 Hektar,
auf denen Kartoffeln, Selle-
rie, Kleegras und Weizen an-
gepflanzt werden, doch sie stehen
unter besonderer Beobachtung.
Und unter einem besonderen Dach.
In einer Höhe von fünf Meter rei-
hen sich Photovoltaikmodule anei-
nander, oben soll Strom produziert,
unten Landwirtschaft betrieben wer-
den, 3,2 Millionen Euro Fördergeld
stecken in dem vom Fraunhofer-In-
stitut für Solar Energiesysteme ISE
koordinierten Forschungsprojekt,
die „Basis“ der Agrophotovoltaik-
Forschungsanlage im deutschen
Herdwangen-Schönach stammt aus
Tirol, entworfen, konstruiert und
aufgestellt von Hilber Solar.
„Wir haben schon oft besondere
Anlagen gebaut“, sagt Firmenchef
Franz Hilber, „etwa in Südspanien.“
Auf einem teilweise stark geneigten
Gelände wurden zwischen einigen
Stützen Stahlseile gespannt, auf die-
sen die Solarpaneele befestigt: „Kniff-
lig war die Frage, wie das alles am
Berg halten soll.“ Und Fraunhofer
suchte jemanden, der solch knifflige
Fragen lösen könnte, ein Projekt-
partner meinte: „Frag mal im Tiroler
Ort Trins nach.“ Fraunhofer meldete
sich, Franz Hilber überlegte – und
lieferte die Lösung.
„Wir mussten mehrere Vorausset-
zungen erfüllen: kein Beton für die
Verankerung; so hoch, dass ein Mäh-
drescher unten durchfahren kann;
dreimal so breit wie ein Mähdre-
scher; Vereisung darf kein Problem
darstellen; so standfest, dass eine
Säule umgefahren werden könnte;
so konstruiert, dass ein bestimmte
Menge Sonnenlicht durchkommt“,
erzählt Hilber. Seit September 2016
steht die Anlage, das Stahlgerüst
ruht auf Spinnanker-Stäben, die acht
Meter tief in den Boden eingedreht
werden mussten und vollständig und
ohne Bodenschäden zu hinterlassen
wieder entfernbar sind. Für Franz
Hilber passt die Forschungsanlage
genau in seine Firmenphilosophie,
„wir arbeiten sozusagen am Rundhe-
rum von PV-Modulen.“ Zu beachten
seien dabei Fragen der Konstruktion,
des Gewichts, des Preis-Leistungs-
Verhältnisses und der elektrischen
Anlage inklusive Batterie sowie die
Nachvollziehbarkeit: „Wir entwi-
ckeln Produkte z.B. für Photovoltaik-
Kraftwerke und vergeben dafür die
Lizenzen.“
Dem Prinzip der Agrophotovoltaik
kann Hilber viel abgewinnen. Selbst
Bauer, hätten ihn Photovoltaik-
Kraftwerke auf landwirtschaftlichen
Flächen schon immer geschmerzt,
so – geht das Konzept auf – entsteht
ein Doppelnutzen. Bleibt noch die
Frage der Schönheit. Im Obstbau
wäre es wohl kein Problem, zudem
könnten die Module auch als Hagel-
schutz dienen. Mehr Informationen
gibt‘s auf
www.hilbersolar.atbzw.
www.agrophotovoltaik.de]
Qwehrgelegte Rechenstäbe
[ konkret GESEHEN ]
I
m Dezember 1910 zündete der
rumänische Physiker Henri Coandă
probeweise den Strahlantrieb seines
selbstkonstruierten Flugzeugs – der
geplante Bodentest wurde allerdings
zum unfreiwilligen ersten Flugtest,
zudem strömten brennende Gase
am Flugzeugrumpf entlang. Die
Maschine brannte ab, Coandă ließ
den Flugzeugbau bleiben, hatte aber
den Coandă-Effekt entdeckt – die
Eigenschaft strömender Gase und
Flüssigkeiten, gekrümmten Oberflä-
chen zu folgen. Eine Eigenschaft, die
sich das Außerferner Unternehmen
Stocker Technik mit seinen Coanda-
Rechen für Kleinwasserkraftwerke
zunutze macht.
„Neben der Turbine ist vielen
Betreibern vor allem der Rechen als
Bauteil sehr wichtig,“ sagt Geschäfts-
führer Peter Stocker. Möglichst viel
Wasser sollte auf einer möglichst
kleinen Fläche entnommen werden
– und das mit so wenig Geschiebe,
sprich Sand und Steine, wie möglich.
Beim klassischen Tirolerwehr
mit seinen längs der Fließrichtung
angebrachten Rechenstäben liegt,
so Stocker, die Größe der durch-
rutschenden „Partikel“ je nach
Bauart bei mehreren Zentimetern,
die im Abstand von 0,5 bis zwei
Millimeter quer angebrachten
Stäbe des Stocker‘schen Qwehr-
Rechens garantieren eine maximale
Partikelgröße von 0,8 Millimeter
– und das bei annähernd gleichem
Schluckvolumen. Mit ein Grund, dass
Stocker auch abseits von alpinen
Kleinwasserkraftwerken Potenzial
für seine Qwehr-Rechen sieht: „Zur
Wasserentnahme beim Speichersee
haben wir in Salzburg einen Rechen
für eine Beschneiungsanlage ge-
baut, weitere Einsatzmöglichkeiten
wären Brunnen, Badeteiche und die
Industrie.“ Doch nicht nur das gut
„gefilterte“Wasser ist ein Plus, die
ein Zentimeter dicken Rechenstäbe
sind nahezu verschleißfrei – der
längst dienende Qwehr-Rechen ist
beim Kraftwerk Lechleitner Boden
im Lechtal seit acht Jahren im Ein-
satz. Und spart auch Arbeit. Stocker:
„Beim alten Tirolerwehr musste im
Herbst bis zu dreimal amTag das
Laub entfernt werden, mit unserem
System nur einmal in der Woche.“
Info:
www.stockertechnik.atW
ie so oft war es Small Talk
am Gang. „Was machst
du?“ – „Bilderkennung.
Und du?“ – „Ich beschäftige mich mit
Immobilien.“ Im weiteren Gespräch
stellte sich heraus, dass dem einen,
Mario Döller, für seine Arbeit rund
um die automatisierte Bilderken-
nung der Content fehlte, dass der an-
deren, David Koch, nach einer Mög-
lichkeit suchte, Alter und Zustand
von Gebäuden einfach und schnell
klassifizieren zu können. Das Ergeb-
nis des Small Talks an der FH Kuf-
stein Tirol – ImmoPixel, sozusagen
die Dachmarke für zwei FFG-Projekte
mit der FH St. Pölten. Bei ImmoBild
soll ein eigens entwickelter Algorith-
mus aus einem Satellitenbild die La-
gequalität einer Immobilie bewerten.
„Start von ImmoBild war im Jänner
2016, mit dem zweiten Projekt, Im-
moAge, begannen wir schon im Ok-
tober 2016“, berichtet Koch.
ImmoAge, so der Plan, soll ein Ver-
fahren erarbeiten, das Bauperioden
sowie regionale Bauweisen von Einfa-
milienhäusern erkennt – anhand von
Fotos. „Dächer von Einfamilienhäu-
sern in Tirol unterscheiden sich von
jenen im Burgenland, weil sie eine
andere Schneelast zu tragen haben“,
nennt David Koch ein optisches Un-
terscheidungsmerkmal, ein anderes
könnte sich auch durch unterschied-
liche Bauordunungen ergeben. Das
Alter des Hauses kann über Fassaden-
details wie Fenster, Türen, Kamine
etc. eruiert werden, die Vorausset-
zung schafft die Gebäudedatenbank
des Projektpartners Sprengnetter
Austria. „Wir füttern den Computer
mit tausenden Bildern und den da-
zugehörenden Informationen wie
Baujahr, Standort, aber auch den
HWB, den Heizwärmebedarf“, sagt
Koch. Daraus automatische Bildklas-
sifikationsmethoden zu entwickeln,
ist Sache der FH Kufstein Tirol und
der FH St. Pölten. Die Ergebnisse der
ersten Testsamples stimmen das Team
positiv: Ein Sample verortete etwa 20
Häuser richtig in den 1980er Jahren,
nur zwei falsch in den 70ern, eine an-
derer 18 richtig in den 70ern, aber
neun falsch als Einfamilienhäuser
jüngster Bauzeit, da sich, so Koch, der
heutige Trend zu einfachen Flächen
der damaligen Bauweise ähnelt. Ein
anderer grober Durchlauf ergab bei
sieben HWB-Klassen eine 50-prozen-
tige Trefferquote.
Zwei bzw. drei Jahre hat das Team
für die Projekte Zeit, Ideen für
Erweiterungen liegen schon vor.
Wichtig ist den Forschern, dass die
Ergebnisse auch in die Anwendung
kommen, etwa als Tool für Körper-
schaften, um eine Energie-Baseline
von Gemeinden zu berechnen. Oder
als Tool für Laien, um sie bei der Be-
wertung von Einfamilienhäusern zu
unterstützen und die Transparenz in
der Immobilienbranche zu erhöhen.
Koch schränkt aber ein: „Den Immo-
bilienprofi wird es sicherlich nicht
ersetzen.“ ]
Geht es nach den Plänen des ImmoPixel-Teams rund um David Koch, soll ein Algo-
rithmus Bauepochen und regionale Bauweisen von Einfamilienhäusern erkennen.
Digitale Hausbetrachtungen
Mit eigenen Algorithmen will das Forschungsteam ImmoPixel digitalen
Gebäudefotos Informationen über Baujahr und Heizwärmebedarf entlocken.
Foto:s Andreas Friedle,AdobeStock/Dieter Hawlan
Foto: iStockerTechnik
Agrophotovoltaik: Das von Franz Hilber und seinemTiroler Entwicklungsteam
konstruierte Gerüst misst 136 mal 25 Meter. Oben sorgen 720 Bifacial-Module
für 194 kWp Leistung, unten wachsenWeizen, Kleegras, Kartoffeln und Sellerie.
Der Stocker‘sche Qwehr ist ideal für
alpine Kleinwasserkraftwerke.
Agrophotovoltaik:
Doppelte Ernte auf einem Feld
















