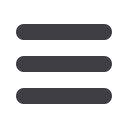
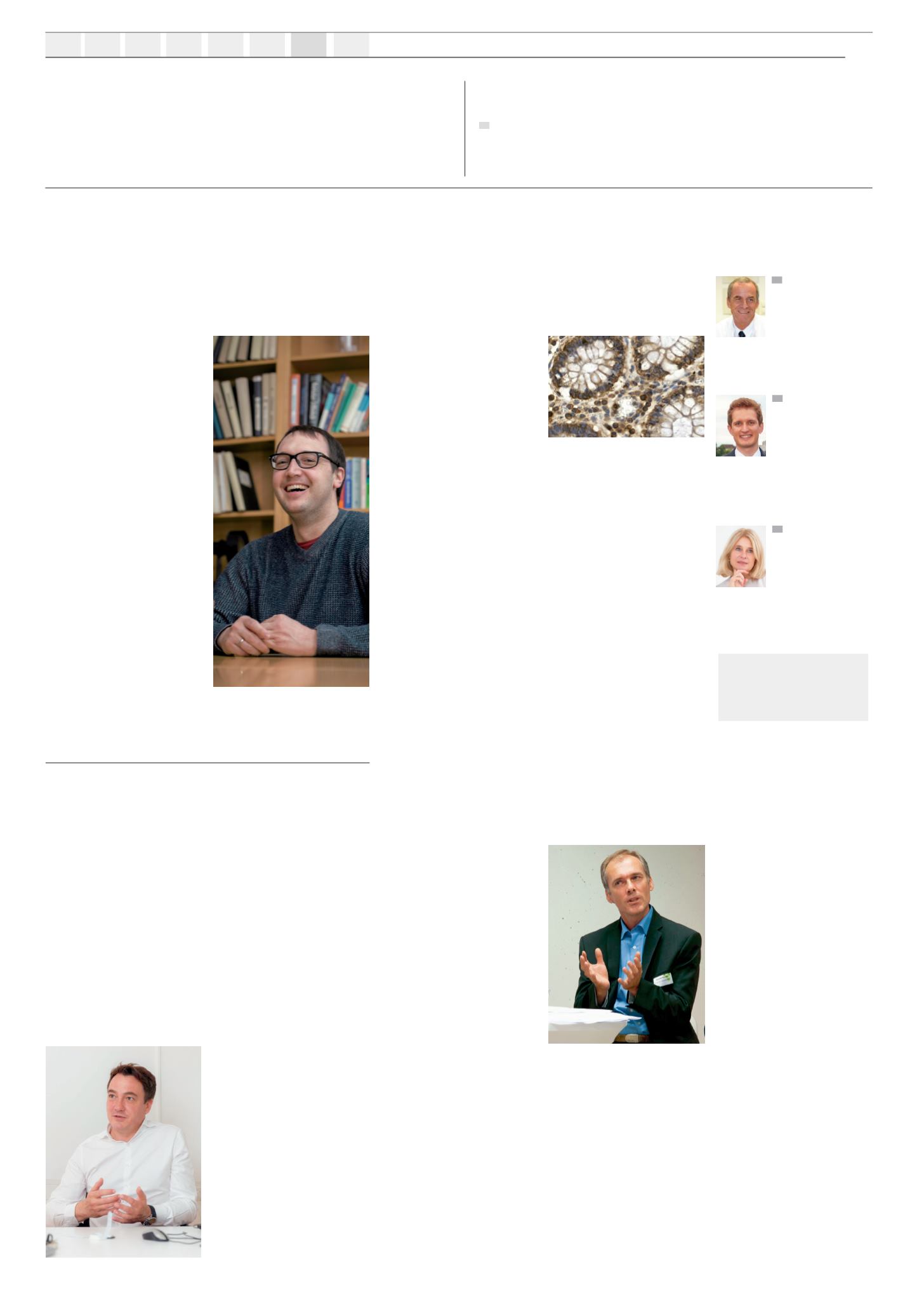
3 2 1
4 5 6
7
8
0317
STANDORT
STANDORT:
Seit Mai 2017 gilt eine
neue EU-Medizinprodukteverord-
nung. Was war die Intention?
MARTIN SCHMID
: Aus meiner
Sicht hängt es mit dem PIP-Skandal
in Frankreich zusammen, wo Brust
implantate mit Industriesilikon ge-
füllt wurden. Darauf wollte man dem
Endverbraucher zeigen, dass man
die Sache im Griff hat. Der erste
Schritt waren die staatlich benann-
ten Prüfstellen. Ihre Qualitätsstan-
dards wurden nach oben geschraubt,
um einen europaweit einheitlichen
Standard für Zulassungen zu errei-
chen. Die Medizinprodukte sind der
nächste Schritt.
STANDORT:
Können Sie die wich-
tigsten Änderungen benennen?
SCHMID
: Es sind zwei Verord-
nungen, eine für Medizinprodukte,
eine für In-Vitro-Diagnostika, den
IVD – da sind die Änderungen um-
fangreicher. Es wird auf eine regel-
basierte Risikoqualifizierung umge-
stellt, das bedeutet, dass statt bisher
20 Prozent rund 80 Prozent der IVD
von einer benannten Stelle erfasst
werden. Viele gibt es in Europa aber
nicht mehr, aufgrund der strengeren
Regeln hat sich die Zahl von rund
80 auf etwa 40 reduziert, von denen
wiederum sind nur circa 15 für IVD-
Produkte zugelassen. Da kann es zu
einem Engpass kommen.
STANDORT:
Gilt die Regelung nur
für neue IVD-Produkte?
SCHMID
: Nein, daher ist es auch ein
Thema für Hersteller, die mit ihren
Tests schon am Markt sind.
STANDORT:
Wie schaut es bei klas-
sischen Medizinprodukten aus?
SCHMID
: Die Regeln ändern sich
nicht so massiv. Kleine Änderungen
gibt es etwa für Software-Produkte,
die nun auch eine benannte Stelle
benötigen.
STANDORT:
Was kommt auf die
Unternehmen zu?
SCHMID
: Unternehmen benötigen
z.B. für Regulierungsfragen eine
Qualified Person. Diese muss Praxis
im Qualitätsmanagement von Medi-
zinprodukten oder ein Hochschul-
studium mit etwas weniger Praxis
vorweisen. Kleinunternehmen kön-
nen das zwar zukaufen, die Chance,
das preiswert zu bekommen, ist aber
nicht sehr hoch, da die Qualified Per-
son mit in die Verantwortung geht.
Solche Personen werden knapp wer-
den und es wird, glaube ich, zu einer
Bremse kommen.
STANDORT:
Können Unternehmen
daran scheitern?
SCHMID
: Es sind kritische Punkte,
weil es Zeitfaktoren sind. Bei Start-ups
können sie Schwierigkeiten bereiten,
aber auch bestehende Unternehmen
werden von der intensivierten Über-
wachung betroffen sein.
STANDORT:
Ab wann wird es ernst
mit der Verordnung?
SCHMID
: Für Medizinprodukte gibt
es eine Übergangsfrist von drei, für
IVD-Produkte von fünf Jahren.
STANDORT:
Sie bieten konkrete
Unterstützung in Form der Open
Lectures an…
SCHMID
: Die Idee dabei ist, etwas
gemeinsam zu erarbeiten. In Wien
nehmen sich z.B. zehn Firmen ge-
meinsam den Inhalt der Verordnung
vor. Man teilt sich die Arbeit auf und
profitiert dann vomWissen des ande-
ren. Das machen wir im Herbst mit
dem Cluster Life Sciences der Stand-
ortagentur Tirol auch in Tirol.
Mehr Infos auf
www.encotec.atoder
www.standort-tirol.at/openlectures]
Martin Schmid: „Bei benannten Stellen
sind schon jetzt Wartezeiten von
einem halben Jahr keine Seltenheit.“
Foto:Human.technology Styria GmbH
„Es kann zu Engpässen kommen“
Technologieberater Martin Schmid über die Änderungen, die auf Unternehmen
der Medizinprodukte-Branche durch eine neue EU-Verordnung zukommen.
EU-Projekt VISAGE hat neue DNA-Fahndungstools im Blick
Die Erstellung eines Phantombilds aus der DNA einer biologischenTatortspur kann zu wichtigen
Fahndungshinweisen führen, diese neuen Ermittlungsansätze können aber auch helfen, Licht in ungeklärte
Verbrechen zu bringen. Das EU-Projekt VISAGE aus dem Horizon 2020 Security-Programm soll nun neue
DNA-Marker erforschen und Fahndungstools entwickeln, die zur Verbrechensaufklärung beitragen. Einer der
13 Projekt-Partner ist das Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck.
SCIENCE
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Life SciencesTirol finden Sie auf
www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Life Science ]
Peter Lukas, Direktor
der Uniklinik für Strahlen-
therapie-Radioonkologie,
wurde mit dem Alfred-
Breit-Preis der Deutschen
Gesellschaft für Radioonko-
logie ausgezeichnet. Der Preis gilt als höchst
dotierte Auszeichnung auf dem Gebiet der
Radioonkologie und honoriert in besonde-
rem Maße wissenschaftliche Aktivitäten.
Den Zusammen-
hang zwischen akutem
Nierenversagen und
Herzinfarkt untersuchte
der Kardiologe Sebastian
Reinstadler und konnte
dabei essenzielle Einblicke in die komplexe
und multifaktorielle Entstehung des akuten
Nierenversagens liefern. Er erhielt dafür den
von Bayer Austria gestiftetenWerner-Klein-
Forschungspreis.
Das im Mai 2015
eingerichtete CD-Labor für
invasive Pilzinfektionen unter
der Leitung von Cornelia
Lass-Flörl, Direktorin der
Sektion für Hygiene und
Medizinische Mikrobiologie, wurde von
einem internationalen Gutachter-Team posi-
tiv evaluiert. Mit diesem Ergebnis kann im
Labor bis 2022 weiter geforscht werden.
Foto: tirol kliniken
Foto:Bayer Austria
Foto:Andreas Friedle
Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]
N
ormalerweise sucht die
Grundlagenforschung den
Weg in die Klinik“, sagt
Alexander Moschen, „bei mir ist es
umgekehrt.“ Als Oberarzt an der
Innsbrucker Universitätsklinik für
Innere Medizin I behandelt er täg-
lich Patienten mit einer chronisch
entzündlichen
Darmerkrankung
(CED), als Forscher will er klären,
welche genaue biologische Rolle das
Gen IFIH1 dabei spielt.
In unserem Darm bilden Billionen
von Bakterien, Viren und Pilzen die
Mikrobiota, allein die Anzahl der
Gene zwischen Dünn- und Mastdarm
übersteigt das menschliche Genom
um ein Vielfaches. Ein ausgeklügeltes
System regelt die Homöostase zwi-
schen Mikroben und Immunsystem
des Darms, dieses Gleichgewicht
kann aber auch gestört sein. Das
Immunsystem beginnt die eigene
Darmflora zu bekämpfen, die Folge
sind Bauchschmerzen, Durchfall und
letztendlich eine dauerhafte Schädi-
gung des Darms. Bis zu 50.000 Öster-
reicher, so die Schätzung, leiden an
einer CED, Tendenz steigend.
„Wir verstehen in der Zwischenzeit
schon viel von diesen Erkrankungen,
deren häufigste Vertreter Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa sind. Wir
verstehen aber nicht, warum welcher
Patient zu welchem Zeitpunkt daran
erkrankt und welche Therapie für
wen die richtige ist“, beschreibt Mo-
schen das klinische Dilemma. Neben
der Erbanlage können Infektionen,
Ernährung und Störungen in der
Immunabwehr mit einer zum Teil
übersteigerten Reaktion auslösende
Komponenten sein. Rund 200 Gene
sind bislang identifiziert, die das erb-
liche Risiko, eine CED zu entwickeln,
erhöhen. Eines davon ist IFIH1.
„IFIH1 ist ein intrazellulärer Re-
zeptor, von dem man ursprünglich
annahm, dass er nur Viren erkennt“,
berichtet Moschen. In der Zwischen-
zeit weiß man, dass IFIH1 auch bak-
terielle Bestandteile erkennt und
über komplexe Signalkaskaden eine
Immunantwort einleitet. Und solche
„Wächter-Proteine“, so Moschen,
spielen bei CED eine wichtige Rolle,
IFHI1 etwa ist am Anschalten von
Entzündungskaskaden in der Zel-
le beteiligt, hat aber auch Einfluss
auf andere intrazelluläre Vorgänge,
über welche seine Arbeitsgruppe
hofft, neue krankheitsrelevante bio-
logische Mechanismen aufzudecken.
Unterstützung findet Moschen dabei
in seinem neuen Christian Doppler
Labor. 800.000 Euro stehen ihm
in den nächsten sieben Jahren zur
Verfügung, je 400.000 kommen von
der öffentlichen Hand sowie vom
Pharmaunternehmen AbbVie.
Doch nicht nur durch seine
Funktion ist IFIH1 interessant.
Das Protein wird sehr stark in der
Darmschleimhaut exprimiert. Diese
Schicht ist quasi das Bindeglied zwi-
schen dem Darm und dem sterilen
Körperinneren. Sie dient hauptsäch-
lich zur Resorption von Nahrungsbe-
standteilen und Wasser, nimmt aber
auch an wichtigen Funktionen des
Immunsystems teil. Diese Lokalisati-
on und erste Forschungsergebnisse
seines Teams sind ein Indiz dafür, ist
Moschen überzeugt, dass IFIH1 ein
wichtiger Player in der Entzündungs-
biologie des Darms und bei der Kon-
trolle der Homöostase ist. ]
IFIH1 ist für Alexander Moschen ein „interessantes Gen“ bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Im Christian Doppler Labor für Mukosale Immunologie will er mit seinem Team nun wissen, wie interessant.
Ein gestörtes Gleichgewicht
[ konkret GESEHEN ]
Punktgenaue Lokalisierung
G
eht es nach Medovis-Proku-
risten Andreas Gereke, schafft
es Harald Blauzahn mit geringem
Energieaufwand ins Gesundheits-
wesen. Der dänische Mittelalter-
König fungiert als Namensgeber der
Bluetooth-Technologie, als Bluetooth
Low Energy (BLE) ermöglicht sie
eine dritte Produktlinie in Gerekes
ProAct-Portfolio, das auf Echtzeitlo-
kalisierungen in Kranken- und Pflege-
einrichtungen spezialisiert ist.
„Im Jahr 2010 ging das erste
ProAct-Personennotrufsystem an
der Innsbrucker Universitätsklinik
für Psychiatrie in Betrieb“, erzählt
Gereke. Ausgangspunkt war ein For-
schungsprojekt des Unternehmens
ITH Icoserve, in dem Anwendungs-
bereiche für neue Lokalisierungstech-
nologien wie RFID gesucht wurden.
Angedacht war z.B. ein OP-Sicher-
heitssystem, um via TAG-Ortung zu
prüfen, ob der richtige Patient zum
richtigen Zeitpunkt in den richtigen
OP-Saal kommt.Technisch zwar
machbar, aber zu aufwendig, war das
Fazit, als leichter umsetzbar erwies
sich das Personennotrufsystem für
Klinikpersonal. Eine Art Pager dient
als Notfrufmöglichkeit, ausgelöst
erhalten die Kollegen eine Nachricht
inklusive Ortung. „Bei der ersten
Umsetzung hat uns die enge Zusam-
menarbeit mit den Anwendern sehr
geholfen“, sagt Gereke. Ein zweites
Standbein ist das Desorientierten-
schutzsystem, das mittelsWLAN
oder RFID das Personal informiert,
wenn ein desorientierter Patient
die für ihn erlaubte Zone verlässt
und wo er zu finden ist. In rund
70 Gesundheitseinrichtungen, vor
allem in der Schweiz und Österreich,
kommen die Lösungen von Medovis,
das 2016 die ProAct-Sparte der ITH
Icoserve übernommen hat, zum Ein-
satz, in Zukunft, so der Plan, auch mit
BLE-Technologie. In einem Innovati-
onsprojekt des Landes Tirol werden
kleinere, leichtere und sparsamere
BLE-Chips getestet, auch neue (und
alte) Anwendungsmöglichkeiten ste-
hen am Forschungsprogramm. Gere-
ke: „Eine Möglichkeit sehen wir im
Baby- und Gerätetracking im Kran-
kenhaus, die OP-Patientensicherheit
wäre mit BLE weniger aufwendig.“
Mehr Info auf
www.medovis.atAlexander Moschen will denWeg
zu neuen spezifischeren Therapien für
CED-Patienten ebnen.
IFIH1 (okkerbraun) in einer entzünde-
ten Dickdarmschleimhaut.
Foto:Alexander Moschen
Foto:Andreas Friedle
Andreas Gereke: „Am Babytracking
zeigen große Krankenhäuser Interesse.“
Foto:Andreas Friedle
















