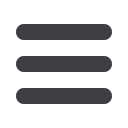

30
· Tätigkeitsbericht 2016 ·
31
Innovations- und Clusterservices
Wie profitieren die
Unternehmen
außerdem davon?
Stefan Wolf: Man
schafft Communi-
ty, Sichtbarkeit und
initiiert Projekte, es
kümmert sich jemand um die Unternehmen des
Clusters. Im Rahmen unserer Möglichkeiten kön-
nen wir außerdem Maßnahmen und Services an-
bieten, die es am Markt sonst nicht gäbe, obwohl
sie regionalwirtschaftlich sinnvoll sind. Hier sind
wir Lückenschließer ebenso wie Vernetzer und
Vertrauensperson. Dass etwas Neues entsteht,
passiert meist durch den persönlichen Kontakt
und gegenseitiges Vertrauen – und es benötigt
immer einen Kümmerer. Diese Kümmerer-
funktion bei Innovationsprojekten übernehmen
wir gerne, denn Unternehmen – insbesondere
KMUs – haben in den seltensten Fällen Zeit und
Ressourcen, dies zu tun. Gäbe es keine Cluster
und man würde Unternehmen fragen, wie die
öffentliche Hand ihnen helfen könne, würden –
davon bin ich überzeugt – viele antworten, dass
es jemanden braucht, der sich um die Vernetzung
zwischen Unternehmen und zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft kümmert.
In einer breiten Befragung setzte sich die
Standortagentur Tirol zwischen Mitte 2015
und Mitte 2016 mit der Situation, den Bedürf-
nissen und den Entwicklungsmöglichkeiten
der Tiroler Unternehmen auseinander. Kann
man das Ergebnis auf entscheidende Punkte
herunterbrechen?
Stefan Wolf: Wir wollten wissen, ob das, was
zum Beispiel die Cluster seit einigen Jahren
machen, noch das ist, was die Unternehmen
Die Kümmererfunktion bei
Innovationsprojekten übernehmen
wir gerne, denn Unternehmen
haben in den seltensten Fällen Zeit
und Ressourcen, dies zu tun.
Innovations- und Clusterservices
Lückenschließer
Cluster war DAS wirtschaftspolitische Schlagwort
des beginnenden 21. Jahrhunderts, vor 15 Jahren
war alles Cluster. Wie hat sich die Clusteridee
seither entwickelt?
Stefan Wolf: Cluster als wirtschaftspolitisches
Instrument sind eine Entwicklung der Ende 1990er,
Anfang 2000er Jahre. Dieses Konzept kam damals neu
auf und war für die Wirtschaftspolitik ein passendes
Instrument, um in einer Region Technologie und
Innovation auf eine andere Art und Weise zu stärken
als mit monetären Förderungen allein. Seither haben
sich die Cluster etabliert, auch wenn in einzelnen
Fällen wie in Wien sich die Rahmenbedingungen der
Wirtschaftspolitik geändert haben und man dort auf
andere Instrumente setzt. Es entstehen aber auch
immer noch neue Cluster, aktuell etwa der Silicon Alps
Cluster zum Thema Mikroelektronik in Kärnten und
in der Steiermark.
Ein länderübergreifender Cluster ist eher etwas
Ungewöhnliches.
Stefan Wolf: Ja, weil Cluster tendenziell von regi-
onalen Akteuren organisiert und in Österreich mit
Landesgeldern finanziert werden. Nichts desto trotz
arbeiten aber etwa die Tiroler Cluster eng mit anderen
Bundesländern zusammen wie etwa mit unseren ober-
österreichischen bzw. niederösterreichischen Partner-
agenturen. Dabei funktionieren Best-Practice-Reisen,
Kooperationsbörsen etc. sehr gut. Innovative Koopera-
tionsprojekte – die Champions League der Clusterar-
beit – mit Partnern aus mehreren Ländern müssen, da-
mit sie wirklich zustande kommen, gefördert werden.
Für solche überregionalen Kooperationen, also wenn
Unternehmen bzw. wissenschaftliche Einrichtungen
aus verschiedenen Bundesländern zusammenarbeiten
wollen, gibt es derzeit wenige passende Landesförde-
rungen. Alternativ kämen EU-Programme in Frage,
diese sind aber meist sehr komplex oder kompetitiv.
Wie kann ein Standort von
Clustern profitieren?
Stefan Wolf: Regionen bzw. Bundesländer setzen
gezielt auf Forschungs- oder Innovationstechnologien,
von denen zukünftige Wertschöpfung erwartet wird.
In Tirol hat man sich auf sechs Felder verständigt, in
denen – als Voraussetzung für Innovation – die nötige
wissenschaftliche Expertise und eine kritische Masse
an Unternehmen existieren. Über Cluster kann man
nun wirtschaftspolitisch steuernd eingreifen, effektiv
Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen und
damit den Unternehmen mit relativ geringen Ressour-
cen unter die Arme greifen.
Wie findet Clusterarbeit statt?
Stefan Wolf: Grundsätzlich arbeiten wir nach dem
österreichischen Clustermodell, das nach fünf Hand-
lungsfeldern funktioniert: Information, Qualifizierung,
Kooperation, Internationalisierung und Öffentlich-
keitsarbeit. Alles, was wir tun, ordnen wir diesen fünf
Themen unter. Zusätzlich haben wir in Tirol pro
Cluster Schwerpunktthemen eingeführt, um die wir
uns in zwei- bis dreijährigen Laufzeiten speziell küm-
mern. Bei unseren Aktivitäten achten wir auch sehr auf
branchenübergreifende Kooperationen im Sinne einer
cross industry innovation – auch dadurch bedingt,
dass bis auf den Holzcluster Tirol alle Cluster in einer
Einrichtung, der Standortagentur Tirol, organisiert
und die einzelnen Einheiten aufgrund der geringen
Größe sehr agil sind. Ziel unserer Clusterarbeit ist
es, Unternehmen bei der Entwicklung innovativer
Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen, damit
diese ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und wir
gemeinsam bestehende Arbeitsplätze sichern und neue
schaffen können.
Neue Geschäftsmodelle, internationale
Branchentrends und Finanzierungsfragen
beschäftigen Tirols Unternehmen, die Cluster in
der Standortagentur Tirol reagieren darauf mit
neuen Services. Wie genau, erklärt Stefan Wolf.
















