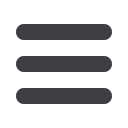
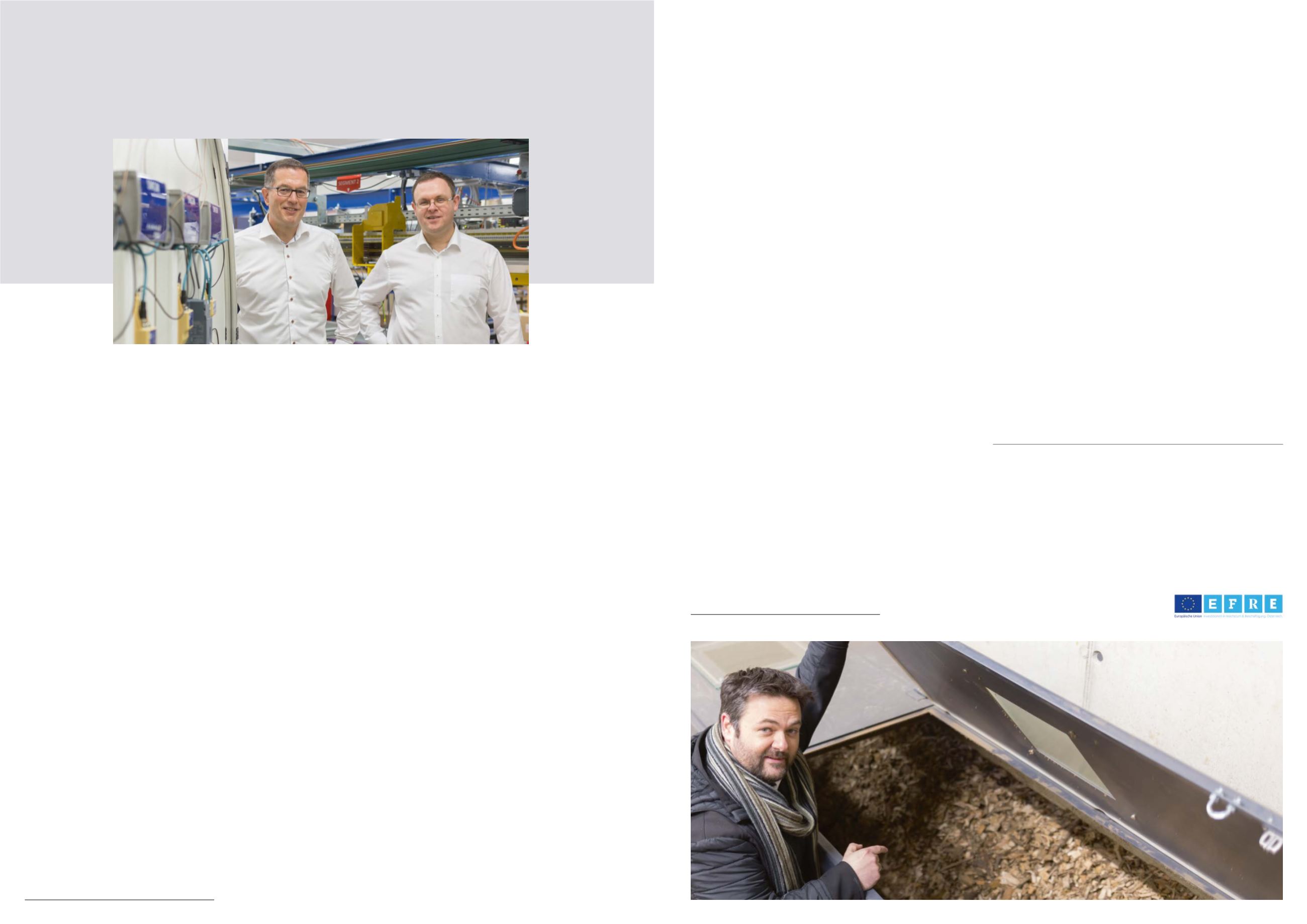
15
Hintergrund
Die Standortagentur Tirol berät und begleitet Tiroler Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen bzw. Konsortien von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft
kostenlos beim Einwerben von Technologieförderungen bei Land, Bund und EU. Das
Service reicht vom Einschätzen der Förderbarkeit von Innovationsvorhaben und
das Empfehlen des geeigneten Programms über das Unterstützen beim Erstellen von
Förderanträgen und bei der wirtschaftlichen Projektplanung bis hin zumHerstellen
von Kontakten zu Know-how-Trägern an den Tiroler Forschungseinrichtungen oder
spezialisiertenWirtschaftspartnern. Leistungszahlen lesen Sie auf Seiten 50 und 51.
Das Landesprogramm K-Regio, zu dem die Standort
agentur Tirol im Berichtsjahr 2016 eine neue Ausschrei-
bung öffnen konnte, wird aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.
Förderberatung
lionen Euro) errichtet, es erreicht eine Brennstoffwärmeleistung von
892 Kilowatt, 261 Kilowatt elektrische und 393 Kilowatt thermische
Leistung. Eingesetzt wird handelsübliches, regionales Waldhackgut, in
drei befahrbaren Trocknungsboxen wird dem Brennstoff mit der anfal-
lenden Niedertemperaturwärme die Feuchtigkeit entzogen.
Marcel Huber kann aber noch auf einen weiteren Vorteil seiner Tech-
nologie verweisen – es gibt keinen Abfall, als einziges Nebenprodukt
fällt Biokohle an, die nicht entsorgt werden muss, sondern genutzt
werden kann: Dünger beigemengt, verhindert sie, dass dieser ausge-
waschen wird, als Güllezusatz mindert sie die Geruchsbelästigung.
Die ersten zwei realisierten Syncraft-Werke produzieren 100 Tonnen
Biokohle im Jahr, diese wird als Tierfutterzusatz oder zur Herstel-
lung von Erde verkauft. „Die Reste, die bei anderen Systemen Kosten
verursachen, zahlen bei uns das Personal“, schmunzelt Huber, der in
einem Forschungsprojekt noch weitere Einsatzgebiete für die Biokohle
gesucht hat – und auch fündig wurde. Der Kohlenstoff könne etwa
zur Wasser- und Abwasserreinigung eingesetzt werden, auch bei der
Kompostierung sei er hilfreich. Hubers Lieblingsidee ist aber eine an-
dere. „Die Kohle eignet sich sehr gut als Grillkohle, sie ist fast rauchfrei
und hinterlässt nur wenig Asche“, berichtet der Unternehmer. An die
100 Tonnen Kohle, schätzt er, würden in der Rossau im Jahr anfallen,
zu wenig, um regional nachhaltige Grillkohle, die ja noch brikettiert
werden müsste, wirtschaftlich produzieren zu können. Anders wäre es,
würde man sich mit zwei, drei weiteren Anlagen zusammenschließen.
„Ein Grillkohlezertifikat haben wir schon“, gibt er sich optimistisch.
Alles, was der Wald hergibt – Holz inklusive
Rinde und Feinanteil – kommt in die Anlage,
lediglich gehackt und getrocknet,
„Wir helfen Unternehmen dabei,
ihre Projekte in den Anträgen
klar darzustellen und die formalen
Kriterien einzuhalten.“
Johannes Rohm ·
Unternehmensförderung, Standortagentur Tirol
14
· Tätigkeitsbericht 2016 ·
Förderberatung
ist die Zukunft der Autoproduktion Rich-
tung Inselfertigung, um flexibel herstellen zu
können. Dazu brauche es, weiß Huber, ein
flexibles Transportsystem, das nicht wie ein
geschlossenes, starres Förderband funktio-
niert, sondern autonome Abläufe zulässt. Die
Energieübertragung verläuft im Boden und
wird berührungslos an die mobilen Fahrzeuge
übertragen. Zur Optimierung der Baugröße der Komponenten arbeitet
das System mit 140 Kilohertz anstatt der bisher verwendeten 20 Kilo-
hertz zur Energieübertragung.
Für Innovationen wie diese habe man am Markt nur ein gewisses
Zeitfenster, ist sich Thomas Streicher bewusst: „Kann man sie liefern,
bekommt man den Auftrag, wenn nicht, dann nicht.“ Um die Abstim-
mung mit der Vahle-Zentrale in Kamen bei Dortmund zu verbessern,
installierte – und wartet – Huber etwa ein Planungsprogramm, ein
weiterer Schritt in Richtung verbesserter Produktentwicklung. Das sei
auch die Aufgabe eines Innovationsassistenten, ist Streicher überzeugt,
nicht die Technik im Unternehmen zu definieren, sondern diese zu
kanalisieren, zu unterstützen und zu verbreiten, insofern, bestätigt
Huber, sei die Aufgabe genau das, was er erwartet hat: „Für ein neues
Produkt muss man Strukturen schaffen, die einzelnen Zwischenpunk-
te müssen auch genau ausgearbeitet werden.“ Natürlich habe er eine
Einarbeitungszeit gebraucht, räumt Huber ein. „Dieser ‚Startballast‘
wird aber durch die Förderung des Innovationsassistenten durch das
Land Tirol kompensiert“, nennt Streicher einen Pluspunkt des För-
derprogramms. Überhaupt, ist er überzeugt, motivieren Förderungen
dieser Art Unternehmen eher, Neues anzugehen: „Sonst schiebe ich es
vor mir her.“
Vor sich hergeschoben wird bei Vahle-Deto in den nächsten Monaten
eher weniger. Neben dem Neubau – inklusive Demo-Anlagen und
Testbahnen für neue Produkte – in Schwoich denken die Automa-
tisierungsexperten schon daran, ihre VPower-140-Technik auch für
Elektrohängebahnen zu adaptieren.
E
s war eine klassische Stellenanzeige, die
Werner Huber auf den Job als Innova-
tionsassistent bei Vahle-Deto aufmerksam
gemacht hat. „Das Automatisierungsthema
Richtung Industrie 4.0 hat mich angespro-
chen“, sagt Huber. Das Unternehmen Vahle
war dem studierten Wirtschaftsingenieur ein
Begriff, gerechnet hat er daher mit dem Raum
Dortmund. Dass Vahle-Deto am Standort Kufstein beheimatet ist,
wusste er nicht, als Bayer habe er sich aber gedacht: „Da geh ich doch
gerne hin.“
„Angekommen“ bei Vahle-Deto ist Werner Huber im Mai 2016, seither
habe er eine Kernrolle in der Firma, erklärt Thomas Streicher, Leiter
der Produktentwicklung bei Vahle-Deto. Begonnen hat es in Kufstein
im Jahr 1996, als Alfred della Torre das Unternehmen Deto gründete
und sich auf die Entwicklung und Produktion von elektronischen Steu-
erungssystemen für Förderanlagen in der Autoindustrie spezialisierte.
2013 kam es zum Joint Venture mit der deutschen Vahle-Gruppe, ein
Spezialist für mobile schleifleitergebundene Energieübertragung. Die
Kombination aus Deto-Steuerungssystemen und der Vahle-Kompe-
tenz für Energieübertragung überzeugte am Markt – Großaufträge
in Millionenhöhe aus der Industrie u.a. von Daimler, BMW, Audi und
Hyundai bestätigen den Erfolgsweg. „Das Wachstum machte es aber
auch notwendig, den Produktentstehungsprozess mit verschiedenen
Meilensteinen klarer zu definieren“, sagt Streicher. Meilensteine, die
den Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt klar aufzeigen und
auch – für weitere Innovationen – adaptierbar sein sollen. Aufgebaut
wurde die Struktur gemeinsam mit Werner Huber aber nicht in der
Theorie, sondern, so Streicher, an einem konkreten Projekt, das gerade
angestanden ist.
VPower 140 nennt man das Projekt firmenintern, das aus einem
Vahle-Projekt zur induktiven Ladetechnik für E-Mobile entstanden
ist. „Diese Technologie wollen wir auf Flurtransportsysteme bzw.
Automated Guided Vehicles umlegen“, erläutert Streicher. Hintergrund
Bei Vahle-Deto im Tirol Unterland
setzt man auf Wachstum und einen
klar definierten Innovationsprozess.
Helfen soll dabei Innovationsassistent
Werner Huber.
Innovative Automatisierer
Entwicklungsleiter Thomas Streicher und
Innovationsassistent Werner Huber (re.):
Den Prozess der Produktentwicklung klar
strukturieren.
















